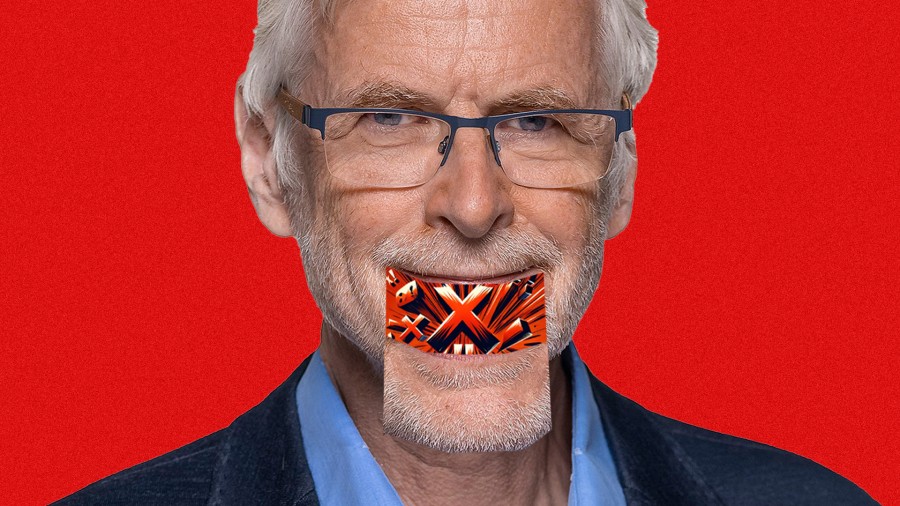Grüne im Zwiespalt: Habeck unter Baerbock
Berlin. Die Grünen stehen kurz davor, ihr bestes Wahlergebnis zu erreichen, doch das angestrebte Ziel bleibt unerfüllt. Ein Mitgrund dafür ist das Aufeinandertreffen mit anderen politischen Gruppen.
Kann man von einem Erfolg sprechen? In Kreuzberg wird im Festsaal jubiliert, als um 18 Uhr die ersten Prognosen von der ARD auf den Bildschirm flimmern. Der grüne Balken erreicht anfänglich eine Höhe, die fast der von September 2021 entspricht, doch später nimmt er ab. Eine fast identische Abstimmung wie bei der vorherigen Wahl – ist das genug für einen Grund zur Freude?
Die Bewertung des grünen Wahlergebnisses hängt stark vom verwendeten Maßstab ab. Vergleicht man die aktuellen Zahlen mit früheren Wahlergebnissen der Partei, sieht es nach einem Erfolg aus – es könnte der zweithöchste Stimmenanteil sein, den die Partei je bei einer Bundestagswahl erzielen konnte. Nur das Ergebnis von 2021 war besser. Vergleicht man jedoch den aktuellen Kanzlerkandidaten Robert Habeck mit der vorherigen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock, gelangen Habeck entsprechende Wertungen, doch übertrifft er sie nicht.
Nimmt man die Zustimmung, die die Grünen an diesem Wahlabend erhalten haben, im Kontext des Ausgangs der Wahlkampfanziele nach dem Zerfall der Ampel-Koalition, zeigt sich: Diese Ziele wurden deutlich verfehlt.
Robert Habeck trat mit dem Ziel an, Kanzler zu werden – als eine Art Rückkehr zu einem Gespräch, in dem er „die Verantwortung suchen“ wollte. Die Grünen sahen sich als Bewegung, die nach der mühsamen Zeit innerhalb der Ampelregierung Erneuerung und Optimismus vermitteln wollte.
Der Wahlkampf, der in den Wohnzimmern begann, brachte dennoch einige Erfolge: Nach dem Zerfall der Ampel-Regierung zählte die Partei laut eigenen Angaben 42.000 neue Mitglieder, sodass sie nun insgesamt rund 169.000 Mitglieder hat. Wahlveranstaltungen waren gut besucht, und die Zustimmung stieg nach einem Umfragetief zum Ende der Regierung wenigstens etwas an.
Die Strategie kam allerdings vor allem bei den eigenen Anhängern gut an: Die Kernwählerschaft der Grünen ist deutlich gewachsen und stabil geblieben. Über diese Wählerbasis hinaus zu mobilisieren, ist ihnen jedoch schwergefallen.
„Das war genau der Wahlkampf, den ich führen wollte“, äußerte Robert Habeck am Wahlabend. Man könnte hinzufügen: Es war der Wahlkampf, den er bereits 2021 hätte führen wollen, solange Annalena Baerbock nicht Kanzlerkandidatin gewesen wäre.
Doch 2025 ist nicht gleich 2021. Das Konzept des „Bündniskanzlers“, das die Grünen propagierten, hat offenbar bei vielen Wählerinnen und Wählern nicht ausgereicht, um die in den letzten Jahren entstandenen Bilder zu revidieren: Habeck als Klimaschutzminister, der jene sehr umstrittenen Projekte wie das Gebäudeenergiegesetz vorantrieb, und als Wirtschaftsminister, unter dem trotz bewältigter Energiekrise eine drei Jahre andauernde Rezession begann.
Die internen Schwierigkeiten im Wahlkampf haben zusätzliche Schäden verursacht. Im Vergleich zu den ehemaligen Koalitionspartnern schneidet die Grüne Partei jedoch relativ glimpflich ab – sie hat am Sonntag die geringsten Blessuren aus den anstrengenden Ampeljahren davongetragen. So ist die Stimmung auf der Wahlparty eher gedämpft, aber dennoch zufriedenstellend. Eine Grüne brachte es passend auf den Punkt: „Wir müssen nicht in Sack und Asche gehen.“ Dennoch ist die Besorgnis über die bevorstehende schwierige Regierungsbildung spürbar.
Es bleibt jedoch nicht ohne Folgen: Die Partei, die stets betonte, Verantwortung zu übernehmen, ging immer wieder Kompromisse mit der SPD und den Liberalen ein. Dies führte jedoch zu einer massiven Überbelastung ihrer Basis und zu Spannungen mit dem Umfeld. Besonders schmerzhaft war dies im Bereich der Migrationspolitik, wo die Grünen unter anderem härtere Abschieberegeln und andere restriktive Maßnahmen mittrugen. Gerade Robert Habecks gewagter 10-Punkte-Plan zur Migrationspolitik sorgte für Widerstand im linken Flügel der Partei.
Junge Wähler der Grünen sehen in der Migrationspolitik ein zentrales Thema und nehmen große Distanz zur strengen Linie der Unionsparteien wahr. Mit dem unerwarteten Comeback der Linkspartei erblickt diese Wählerschaft zudem eine andere Option.
Habecks Darstellung, dass die Abstimmung der Union mit der AfD im Bundestag einen Einfluss auf die Wählerschaft hatte, heben viele hervor. Nach dieser Vorfälle hätten viele gemerkt, „so nicht – nicht mit der Union“ zu regieren. Allerdings wäre es für ihn undenkbar gewesen, eine Zusammenarbeit mit einer demokratischen Partei von vornherein abzulehnen.
Zudem hat CSU-Chef Markus Söder in der letzten Zeit unermüdlich und lautstark eine schwarz-grüne Koalition zurückgewiesen. Ob eine solche Koalition rechnerisch möglich sein wird, bleibt abzuwarten – die Mehrheitsverhältnisse hängen von den letzten Fraktionen im Parlament ab. Über die Möglichkeit einer Kenia-Koalition mit der Union und der SPD könnte ebenfalls nachgedacht werden. Doch die Frage bleibt, ob weiterhin grüne Regierungsarbeit machbar bleibt – auch dies könnte ein weiterer Maßstab für den zukünftigen Erfolg sein.