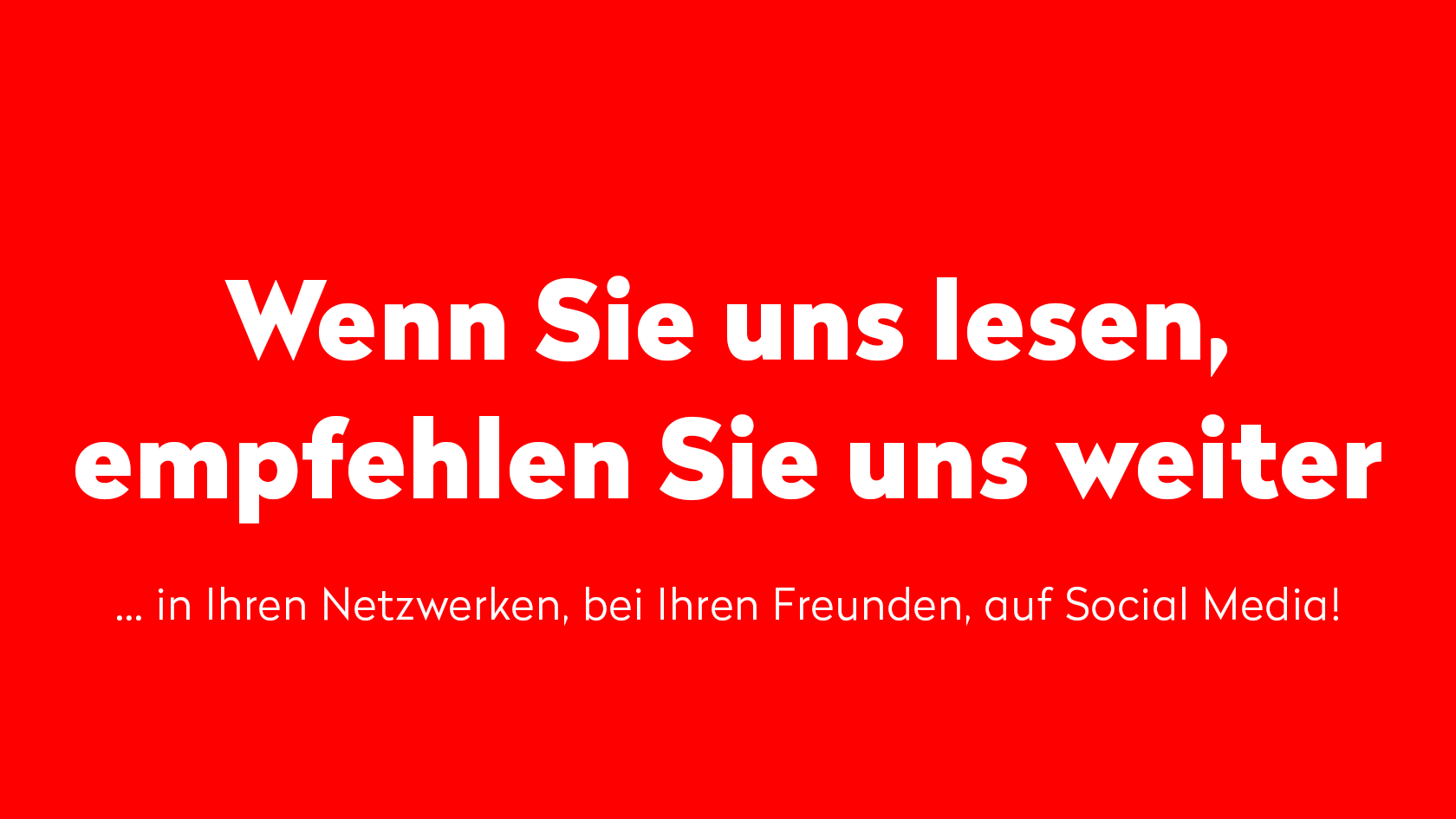Die Herausforderungen der Rentenpolitik in Deutschland vor der Bundestagswahl 2025
Mit dem Eintritt der geburtenstarken Jahrgänge in den Ruhestand sieht sich die Rentenfinanzierung in Deutschland vor großen Herausforderungen. Die Parteien vertreten unterschiedliche Ansichten darüber, wie die Altersvorsorge in Zukunft gestaltet werden sollte.
Eine wachsende Anzahl von Rentnerinnen und Rentnern ist bereits in den alten Bundesländern zu verzeichnen. Im Jahr 2023 erhielten in Brandenburg rund 820.000 Menschen finanzielle Unterstützung aus der gesetzlichen, privaten oder betrieblichen Rentenversicherung, was einen Anstieg von fast 7.000 im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Auch in Berlin stieg die Zahl der Rentenein Empfänger, die mit über 822.000 fast gleich viele waren. Angesichts der demografischen Veränderungen und der damit verbundenen Herausforderungen müssen sich alle Parteien mit der Frage der Rentensicherung auseinandersetzen.
Die Ausgaben für Renten sind in den letzten Jahren stark gestiegen. Im Jahr 2023 betrugen die Rentenausgaben in Brandenburg etwa 15,3 Milliarden Euro, was ein Plus von 854 Millionen Euro gegenüber 2022 darstellt. In Berlin lagen diese Ausgaben bei ungefähr 14,5 Milliarden Euro. Angesichts dieser finanziellen Last wird deutlich, dass die Absicherung der Rente eine drängende politische Herausforderung ist.
Die durchschnittliche Rente in Brandenburg betrug 2023 1.555 Euro, während sie in Berlin bei 1.470 Euro lag. Trotz dieser Zahlen liegt die Armutsgefährdungsgrenze im gleichen Jahr bei 1.314 Euro, was bedeutet, dass viele Rentner unter dieser Grenze leben müssen.
Die Rentenkasse verzeichnete in 2023 einen leichten Überschuss mit Auszahlungen von 379,8 Milliarden Euro und Einnahmen von 381,2 Milliarden Euro. Der Bund hat jedoch eine wesentliche Rolle gespielt, indem er einen Großteil der Einnahmen zur Rentenfinanzierung beisteuerte. Demnach stammt ein Viertel der Rentenfinanzierung aus Steuermitteln.
Im Kontext der Rentenpolitik sind zahlreiche Fragen aufgetaucht: Wie hoch soll die Rente zukünftig sein und wer soll in die Rentenversicherung einzahlen? Sollen zusätzliche Altersabsicherungen erforderlich sein, und falls ja, wie sollen diese finanziert werden? Die einzelnen Parteien haben sehr unterschiedliche Ansätze.
Die SPD setzt auf stabile Renten und will das gesetzliche Rentenniveau langfristig auf mindestens 48 Prozent des durchschnittlichen Nettoeinkommens sichern. Zudem fordert die Partei die frühzeitige und abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren und möchte das Renteneintrittsalter von maximal 67 Jahren beibehalten.
Die Union hingegen plant, das Renteneintrittsalter beizubehalten und keine Rentenkürzungen vorzunehmen. Um ältere Arbeitnehmer zu ermutigen, länger zu arbeiten, möchten sie eine sogenannte Aktivrente einführen und weitere Anreize zur privaten Altersvorsorge schaffen.
Die Grünen fordern zudem die Umwandlung der gesetzlichen Rentenversicherung in eine Bürgerversicherung, in die auch Selbständige einzahlen sollen. Auch sie setzen auf Anreize, um die Arbeitsaufnahme gegen freiwillige Beiträge zu fördern.
Die FDP hingegen möchte den Menschen einen flexiblen Renteneintritt ermöglichen und plant die Schaffung einer gesetzlichen Aktienrente, während die AfD plant, das Rentenniveau auf 70 Prozent des letzten Nettoeinkommens anzuheben und bei der Geburt eines Kindes Rentenbeiträge zurückzuerstatten.
Die Linke legt Wert darauf, dass alle Erwerbstätigen, einschließlich Selbständigen und Beamten, in das Rentensystem einzahlen und möchte das Rentenniveau von 48 auf 53 Prozent anheben sowie das Renteneintrittsalter auf 65 Jahre senken.
All diese unterschiedlichen Ansätze und Vorschläge werden vor der Bundestagswahl am 23. Februar 2025 entscheidend für die Diskussion über die Zukunft der Rentenpolitik in Deutschland sein, während immer mehr Menschen auf eine sichere Altersvorsorge angewiesen sind.