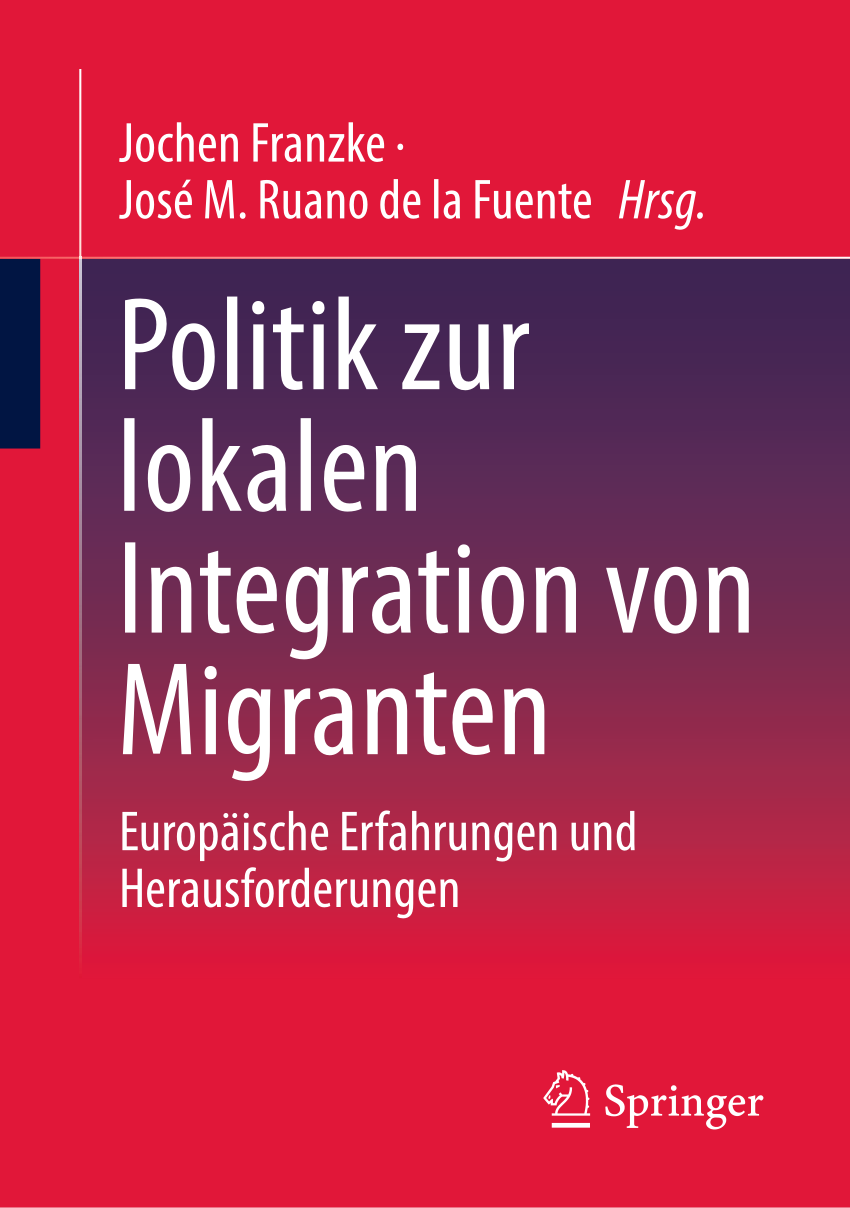Migration in Europa: Ein kritischer Blick auf die Entwicklungen der letzten Jahre
Berlin. Gerald Knaus, Migrationsforscher und Mitgestalter des EU-Türkei-Deals von 2016, äußert sich zur Flüchtlingspolitik der letzten zehn Jahre sowie zu den gegenwärtigen Herausforderungen in der Asylpolitik. Knaus, der die Entwicklungen in Europa genau verfolgt, stellt fest, dass sich die Reaktionen auf Flüchtlingsbewegungen zunehmend unterschiedlich gestalten, wobei viele Länder auf einen nationalen Kurs setzen, der sich als ineffektiv erweist.
Zahlreiche politische Parteien, vor allem die CDU und die AfD, befürworten eine strenge Migrationspolitik, die auf Grenzschließungen, Abweisungen und Kürzungen von Sozialleistungen abzielt. Knaus sieht in diesem Ansatz ein Problem. „Die deutsche Politik lernt wenig aus nunmehr zehn Jahren Flüchtlingspolitik. Wir kennen mittlerweile die erfolgreichen und gescheiterten Maßnahmen“, so Knaus. Deutschland und Österreich, die beide einen hohen Anteil an Schutzsuchenden und Anerkennungen in der EU haben, zeigen, dass nationenbezogene Lösungen nicht den gewünschten Erfolg bringen. Trotz strengerer Maßnahmen in Österreich blieb der Zufluss an Menschen, die Schutz suchen, unverändert.
Im Hinblick auf die Risiken einer verstärkten nationalen Herangehensweise zur Behandlung der Flüchtlingszahlen warnt Knaus, dass solche Strategien in Europa nicht funktionieren. Ein Beispiel dafür sei Deutschland, das, falls man Asylsuchende an der Grenze nicht mehr registriert, ähnliche Konsequenzen in anderen Ländern nach sich ziehen könnte. „Nationale Lösungen führen lediglich zu einem Anstieg von illegalen Einreisen und Untertauchen“, erklärt Knaus. Ein wirksamer Weg sei stattdessen die europäische Zusammenarbeit, die den Erfahrungen der Vergangenheit Rechnung tragen sollte. Die Herausforderung, die Großbritannien bei seinem EU-Austritt festgestellt hat, könnte auch Deutschland bevorstehen: Die unzureichende Kooperation mit anderen Staaten könnte den Zufluss von Geflüchteten nicht stoppen.
Ein weiterer Punkt in der Debatte ist die Diskussion um die Reduzierung von Bargeldleistungen für Asylsuchende zugunsten von Sachleistungen. Knaus hebt hervor, dass dies zwar unter Umständen bei Personen, die ausreisen müssen, wirksam sein könnte, jedoch nicht den Zustrom neuer Asylbewerber aufhalten wird. „Wer Sachleistungen einführt, greift nur an den Symptomen der Asyl- und Migrationsproblematik herum“, so der Wissenschaftler.
Schließlich ist auch der aktuelle Vorschlag der CDU und CSU zu nennen, den Familiennachzug für subsidiär Schutzsuchende, insbesondere aus Syrien, weiter einzuschränken. Knaus weist darauf hin, dass bereits jetzt eine Obergrenze von 1000 Fällen pro Monat besteht. Die Idee dieser Abschreckungsmaßnahmen habe sich in der Vergangenheit als ineffektiv erwiesen. Sein Appell an die Politik lautet, legale und kontrollierte Wege zu schaffen, um weniger Menschen zu ermöglichen, irregulär in die EU zu gelangen.