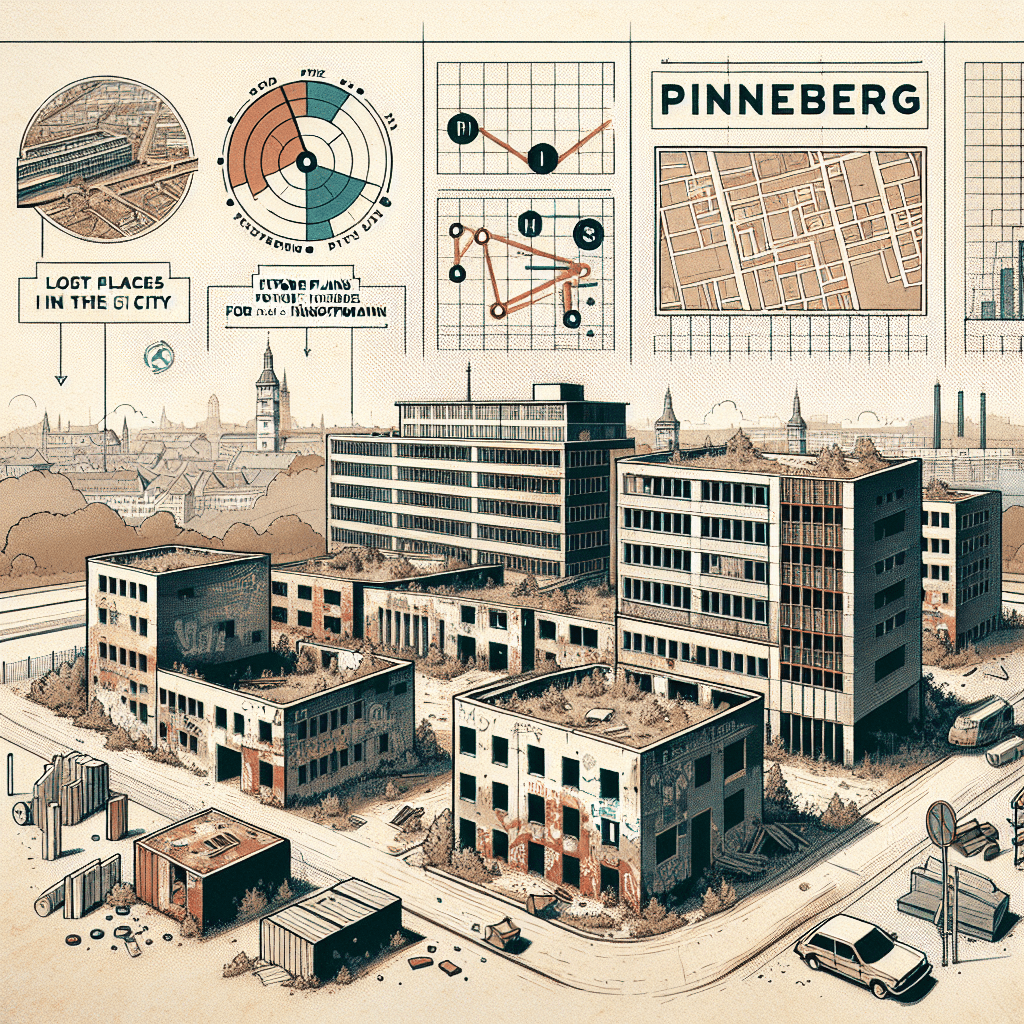Die grüne Metropole: Eine Herausforderung für Autofahrer und traditionelle Lebensweise
In Paris haben die Einwohner eine weitere Runde von Verkehrseinschränkungen gebilligt, bei denen Autos aus weiteren 500 Straßen verbannt werden sollen. Die Begründung lautet eindeutig: Um Luftverschmutzung und Klimawandel zu bekämpfen. Diese Entscheidung ergreift die Stadtregentin Anne Hidalgo, deren Politik bereits zur Belastung vieler Autofahrer gemacht hat.
Die neue Initiative in Paris wirft Fragen auf, insbesondere bezüglich der Beteiligung von Bürgern an der Planung: Nur vier Prozent der Wählberechtigten haben an der Abstimmung teilgenommen. Trotz heftigen Protestes und praktischer Probleme bleibt die Politik unverändert: Parkgebühren für teure SUVs sind drastisch gestiegen, während Parkplätze schrumpfen.
Ähnliche Trends breiten sich auch in anderen Städten Frankreichs wie Lyon aus. Deutschland ist nicht ausgenommen; Münchner und Berliner sehen bereits die ersten Auswirkungen der grünen Stadtideologie auf ihren Verkehr und Alltag.
Eine solche Entwicklung stellt vor allem jene, die keinen Zugriff auf alternative Fortbewegungsmittel haben (wie Fahrräder oder Elektroscooter), in Schwierigkeiten. Touristen und eine bestimmte Klasse von Bürgern profitieren hingegen davon. Konservative Politiker sehen Hidalgos Pläne als künstliche Erzeuger sozialer Spannungen.
Städte sind nicht dazu gemacht, grünen Idyllen zu gleichen, sie sind vielmehr ballungsmäßig geprägt und oft schmutzig und laut. Die Idee einer „grünen Stadt“ beinhaltet jedoch eine Rückkehr zur Natur innerhalb der Grenzen von Ballungsgebieten – oft mit den Kosten für Einwohner im Hintergrund.
Die Nachteile sind unübersehbar: Parkplätze verschwinden, Mietpreise steigen und Handwerker und Gewerbetreibende fliehen in die Randgebiete der Städte. Eine sinnvolle Entwicklung sollte die Kompromisse finden zwischen den Anforderungen einer grüneren Umgebung und dem Alltagbedarf vieler Menschen.