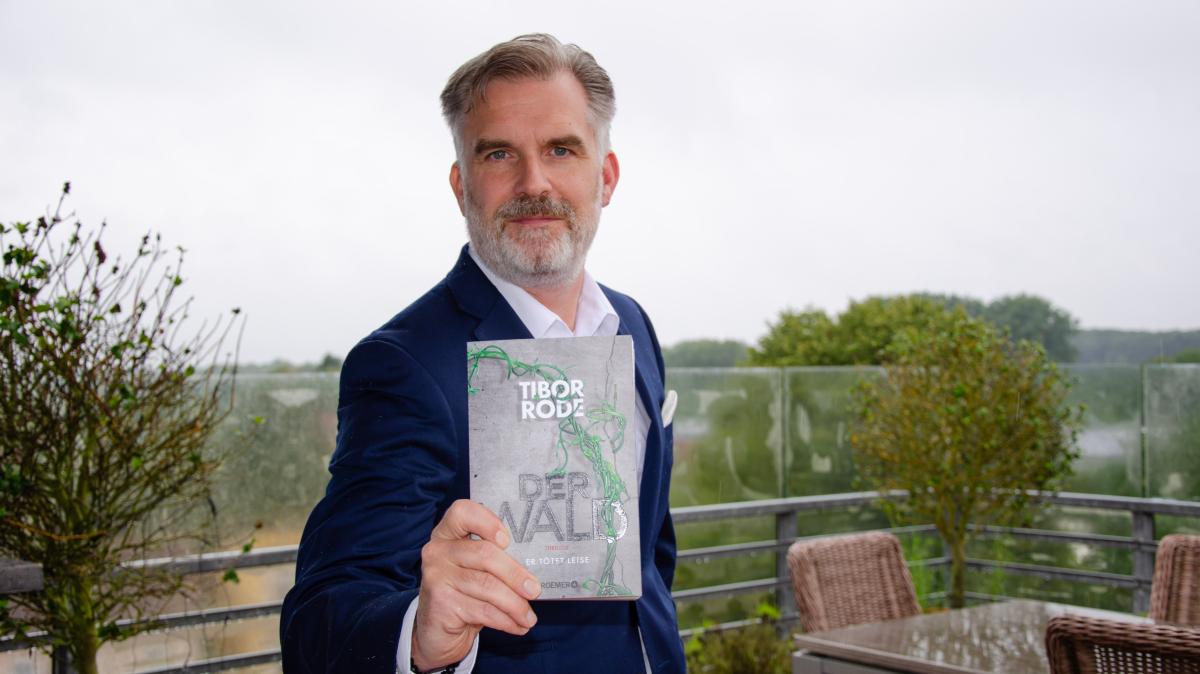Fantasien und ihre Verteidigung
Sollte man zuerst ein Buch lesen und dann die dazugehörige Verfilmung anschauen oder umgekehrt? Diese Frage beschäftigt mich oft, da ich befürchte, dass die visuellen Eindrücke des Films meine eigenen Vorstellungen beim Lesen beeinträchtigen könnten.
Ich erinnere mich an eine Unterrichtsstunde in der sechsten oder siebenten Klasse, als unsere Lehrerin diese Diskussion anregte. Welches Buch wir damals genau behandelt haben, entzieht sich meiner Erinnerung, jedoch erinnere ich mich gut an Titel wie „Robinson Crusoe“ oder „Meuterei auf der Bounty“. Auch die Geschichten von Cooper und Jules Verne spielten in meinem Lesekosmos eine Rolle – Bücher, die ein Junge in diesem Alter zu schätzen wusste. Ich las in der Regel zuerst die Bücher, bevor ich die Filme sah. Karl May war zwar auch ein Thema, seine Werke reizten mich aber nicht wirklich.
Es war nicht wirklich eine bewusste Entscheidung, es geschah einfach so während der frühen 1970er Jahre in der DDR. Filme waren nicht so leicht zugänglich wie heute. Zwar konnte ich gelegentlich bei uns im Schwarz-Weiß-Fernseher einen interessanten Film sehen oder ins Kino gehen, doch die Flut an Bildern, die uns heutzutage umgibt, war damals noch weit entfernt.
Die meisten meiner Mitschüler bevorzugten es, zuerst die Filme zu sehen. Ihrer Meinung nach sei es besser, die Bilder, die sie beim Lesen des Buches verwenden, bereits im Kopf zu haben. Lesen sie das Buch zuerst, stoßen sie auf die Herausforderung, dass ihre eigenen Vorstellungen nicht unbedingt mit dem übereinstimmen, was auf der Leinwand gezeigt wird. Diese Diskrepanz könne stören, glaubten sie.
Ich war anderer Meinung. Schon damals war ich überzeugt, dass ein Film stets eine eigene Interpretation des Buches darstellt. Ich wollte nicht, dass festgelegte Bilder meine Fantasie beim Lesen einschränken. Wie genau ich meine Ansicht im Unterricht ausdrückte, weiß ich heute nicht mehr. Aber sinngemäß könnte ich gesagt haben: Wer sich zuerst die Filme ansieht, verzichtet auf das selbstständige Denken. So sieht eben das Denken eines Jugendlichen aus – manchmal ist es nur Schwarz und Weiß.
Mittlerweile habe ich meine Meinung etwas differenziert. Ich erkenne an, dass einige Filme tatsächlich brillanter sein können als die zugrundeliegenden Bücher. Die Blechtrommel ist ein gutes Beispiel dafür. Dennoch bleibt mein Misstrauen gegenüber Bildern ungebrochen, da sie jedes Mal eine eigene Geschichte erzählen.
Der innere Konflikt zwischen Text und Bild begleitet mich bis heute. Ständig frage ich mich, welche Erzählung mir das Bild vermittelt und welche der Text. Welche Gedanken und Träume erweckt ein Bild in mir, und wie steht dies im Vergleich zu einem geschriebenen Text? Diese Fragen sind nicht trivial und spiegeln sich besonders in der Art und Weise wider, wie Religionen Bilder nutzen. In manchen, wie dem Islam, sind sie etwa gar nicht erlaubt.
Ich möchte hier die Diskussion um Religion und politikfrei halten, doch eines liegt mir am Herzen: Bei der Antwort an meine Deutschlehrerin war es mir wichtig, meine eigenen Fantasien zu verteidigen und nicht den Bildern zuliebe auf diese zu verzichten, nur weil dies weniger Streitigkeiten mit sich bringt.
Quentin Quencher, ein in Glauchau, Sachsen, geborener Autor, der 1983 in die Freiheit aufbrach, fühlte sich in seiner Heimat nie wirklich wohl. Auch im Westen fand er kein Zuhause. Er ist ein Vagabund zwischen verschiedenen Lebenswelten und lebt zur Zeit mit seiner Familie in Baden-Württemberg.
In Ergänzung zu diesem Thema verweist er auf die Problematik der bildlichen Desinformation, die so oft ohne den nötigen Kontext präsentiert wird. Dieser Diskurs wird ebenfalls auf Quentins Blog „Glitzerwasser“ behandelt.