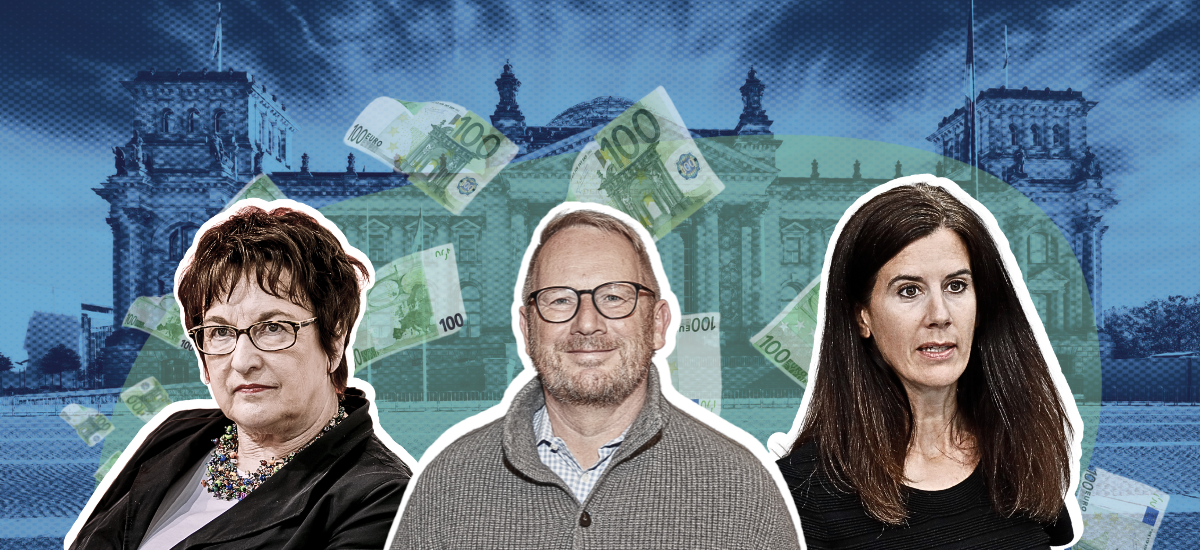Merz und die Herausforderung der Koalitionsbildung nach der Wahl
Friedrich Merz hat seinen Wahlsieg gefeiert und strebt an, spätestens zu Ostern das Kanzleramt zu übernehmen – jedoch nur mit einer Mehrheit, die die AfD ausschließt. Sein Fokus liegt dabei auf der abgewählten SPD. Diese Situation wirft die Frage auf: Was geschieht, wenn auch dieses Regierungsprojekt scheitert?
Die Unionsparteien haben die erste Position bei den Wahlen erreicht. Mit 28,6 Prozent, was einer Zunahme von 3,4 Prozentpunkten für die CDU und 0,8 Prozentpunkten für die CSU entspricht, könnte man das Resultat in anderen Zeiten als mäßigen Erfolg betrachten. Dennoch feierte Merz dies als Sieg. In seiner euphorischen Ansprache versprach er, dass es Zeit für „Rambo Zambo“ sei – eine unglückliche Wortschöpfung, die bei seinen Unterstützern Anklang fand. Dennoch musste Merz zahlreiche Interviews geben und sich der „Berliner Runde“ bei ARD und ZDF stellen.
In diesen Gesprächen war er jedoch oft mit der kritischen Frage konfrontiert, wie er seine Wahlversprechen umsetzen will. Die von ihm geforderten Maßnahmen zur Begrenzung der Migration, einen Kurswechsel in der Wirtschaftspolitik und die Bekämpfung illegaler Einwanderung sind kaum mit SPD und Grünen umsetzbar. Eine Mehrheit könnte er mit der AfD erzielen, doch er hatte klargestellt, dass eine Zusammenarbeit mit dieser Partei ausgeschlossen sei.
Die AfD hat mit 20,8 Prozent ein bemerkenswertes Ergebnis erzielt, das einer Verdopplung gegenüber früheren Wahlergebnissen entspricht. Merz verfolgt jedoch eine Strategie, die eine Koalition mit den Wahlgewinnern ausschließt und auch keine Zusammenarbeit bei bestimmten Themen zulässt, in denen tatsächlich Übereinstimmungen bestehen. Trotz der Vorwürfe der AfD, die Unionsparteien hätten von ihrem Wahlprogramm abgeschrieben, könnte die Union für viele ihrer Positionen auch Ansprüche auf Urheberschaft erheben – vieles stammt aus der Ära vor Angela Merkel. Merz hingegen zeigt sich stark der Merkel-CDU verpflichtet.
Die CSU, angeführt von Markus Söder, hat bereits klargestellt, eine Koalition mit den Grünen abzulehnen. Somit bleibt als Möglichkeit nur eine Verbindung mit der SPD, deren schlechtestes Ergebnis seit Bestehen der Bundesrepublik mit 16,4 Prozent und einem Rückgang von 9,3 Prozentpunkten in den aktuellen Wahlen verbucht wurde. Dies wirft erneut die Frage auf, ob eine Koalition der beiden einstigen Regierungsparteien eine rechnerische Mehrheit erreichen kann.
Die FDP wird mit einem Ergebnis von 4,3 Prozent nicht im Bundestag vertreten sein. Ihr Vorsitzender Christian Lindner nutzte seine letzte öffentliche Äußerung während der „Berliner Runde“, um einen Rückzug aus der Parteiführung anzukündigen und sein Scheitern als persönliches Opfer für Deutschland darzustellen. Im Gegensatz zur FDP blieb das Wagenknecht-Bündnis stabil und lag bis in die späten Nachtstunden bei etwa 5,0 Prozent, sank jedoch in den frühen Morgenstunden auf 4,972 Prozent.
Die Unionsparteien waren unsicher darüber, welche der betroffenen Parteien die Chance auf eine erneute Regierungsbeteiligung bekommen könnte. Man ging davon aus, dass das BSW der Linken einen Einzug in den Bundestag nicht geschafft hatte – die mögliche Mehrheit könnte kurioserweise nur durch den schwächsten Partner, die SPD, zustande kommen.
Die Grünen verloren 3,1 Prozent und landeten bei 11,6 Prozent. Trotz der weit verbreiteten Ablehnung der Ampelkoalition war der Verlust für die Grünen im Vergleich zu SPD und FDP relativ gering, was darauf hindeutet, dass ihre Wählerschaft mit den bisherigen Maßnahmen zufriedener war.
Insgesamt zeigt sich das Bild eines fragmentierten Parteiengefüges, das sich nicht durch Brandmauern aufhalten lässt. Die AfD, die im Osten Deutschlands dominierende Partei ist, hat in einigen Bundesländern Wahlergebnisse zwischen 32,5 und 38,6 Prozent erzielt. Besonders auffällig ist das Ergebnis in Berlin, wo die Linke mit 19,9 Prozent zur stärksten Partei wurde – sehr zur Überraschung der politischen Beobachter.
Die kommenden Tage und Wochen werden entscheidend sein, um herauszufinden, welche Richtung die neue Regierung einschlagen wird. Merz hat klar signalisiert, dass er sich nicht mit der AfD einlassen will. Dies könnte allerdings die Chancen der Union gefährden, eine nachhaltige und erfolgreiche Politik zu gestalten.