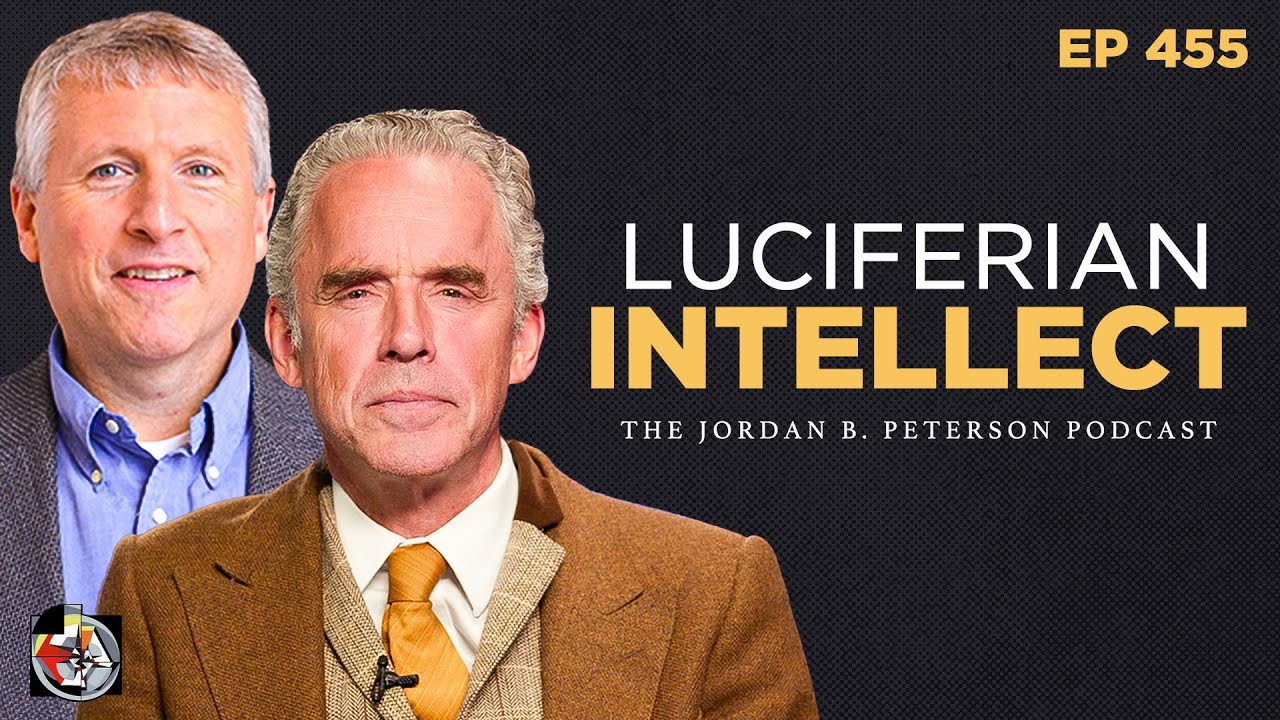Besuche von Gedenkstätten: Pflicht oder Privileg?
In Anbetracht des zunehmenden Antisemitismus an Schulen und der mangelnden Kenntnisse über den Holocaust stellt sich die Frage, ob Besuche in ehemaligen Konzentrationslagern fester Bestandteil des Lehrplans werden sollten. Ein Beispiel hierfür bietet die aktuelle Debatte, die durch die Unionsfraktion im Bundestag angestoßen wurde. Doch wie stehen Schüler, Lehrkräfte und Vertreter der Gedenkstätten zu diesem Thema?
An einem klaren Februartag besucht eine neunte Klasse des Ulrich-von-Hutten-Gymnasiums aus Berlin-Lichtenberg die Gedenkstätte Sachsenhausen. Für viele Schüler ist es der erste Besuch eines ehemaligen Konzentrationslagers. Die Frage, ob solche Besuche Pflicht werden sollten, gewinnt an Bedeutung – insbesondere nach den ansteigenden antisemitischen Vorfällen seit dem 7. Oktober 2023.
Thomas Jarzombek, der bildungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, betont die Notwendigkeit, „die Erinnerung an die Schrecken der Schoah bei den nachkommenden Generationen wachzuhalten“. Eine Umfrage der Jewish Claims Conference verdeutlicht, dass in Deutschland zwölf Prozent der 18- bis 29-Jährigen nicht einmal vom Holocaust gehört haben. Die große Herausforderung besteht darin, das Wissen über die NS-Zeit zu vertiefen und das Bewusstsein für vergangenes Unrecht zu schärfen.
Gegenwärtig ist der Besuch von Gedenkstätten in Berlin und Brandenburg nicht verpflichtend, da Bildung Ländersache ist. In einigen Bundesländern wie Bayern und Saarland gilt bereits eine Besuchspflicht für Schüler der neunten Klasse. Hamburg plant unter der Schulsenatorin Ksenija Bekeris ebenfalls eine Umsetzung im laufenden Jahr.
Das Programm in Sachsenhausen umfasst zunächst einen Workshop, in dem die Schüler sich mit historischen Quellen beschäftigen und anschließend bei einem Rundgang über das Gelände ihr Wissen vertiefen. Der praktische Besuch soll den Schülern helfen, die Holocaust-Geschichte besser zu begreifen, weit über den theoretischen Unterricht hinaus.
Die Eindrücke der Schüler sind eindringlich. Alija schildert: „Natürlich ist Unterricht in der Schule nicht vergleichbar damit, zu diesem Ort zu gehen, wirklich zu sehen.“ Auch Amjad, ein Mitschüler, findet, dass der Besuch ihm ein besseres Verständnis für das leidvolle Leben der Häftlinge vermittelt hat. Dennoch ist er skeptisch gegenüber einer Pflicht: „Es kann ja auch sein, dass manche Leute sich dafür einfach nicht interessieren.“ Ähnlich äußert sich seine Lehrerin, Alma Kittler, die der Meinung ist, dass Lehrkräfte die Freiheit haben sollten, wie sie den Stoff vermitteln.
Die Gedenkstättenleiter ziehen in Betracht, dass ein verpflichtender Besuch junge Menschen emotional überfordern könnte. Es gibt bereits lange Wartelisten für Führungen an vielen Gedenkstätten, und die Ressourcen reichen oft nicht aus, um einen solchen Ansturm zu bewältigen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Diskussion über die Einführung einer Besuchspflicht für Gedenkstätten von verschiedenen Perspektiven geprägt ist. Auf der einen Seite steht der Wunsch nach einer Stärkung des historischen Bewusstseins. Auf der anderen Seite gibt es Bedenken hinsichtlich der individuellen Bereitschaft und der emotionalen Belastung junger Menschen. Der Dialog über diese Themen bleibt somit höchst aktuell und bedeutend für die Erziehung zukünftiger Generationen.