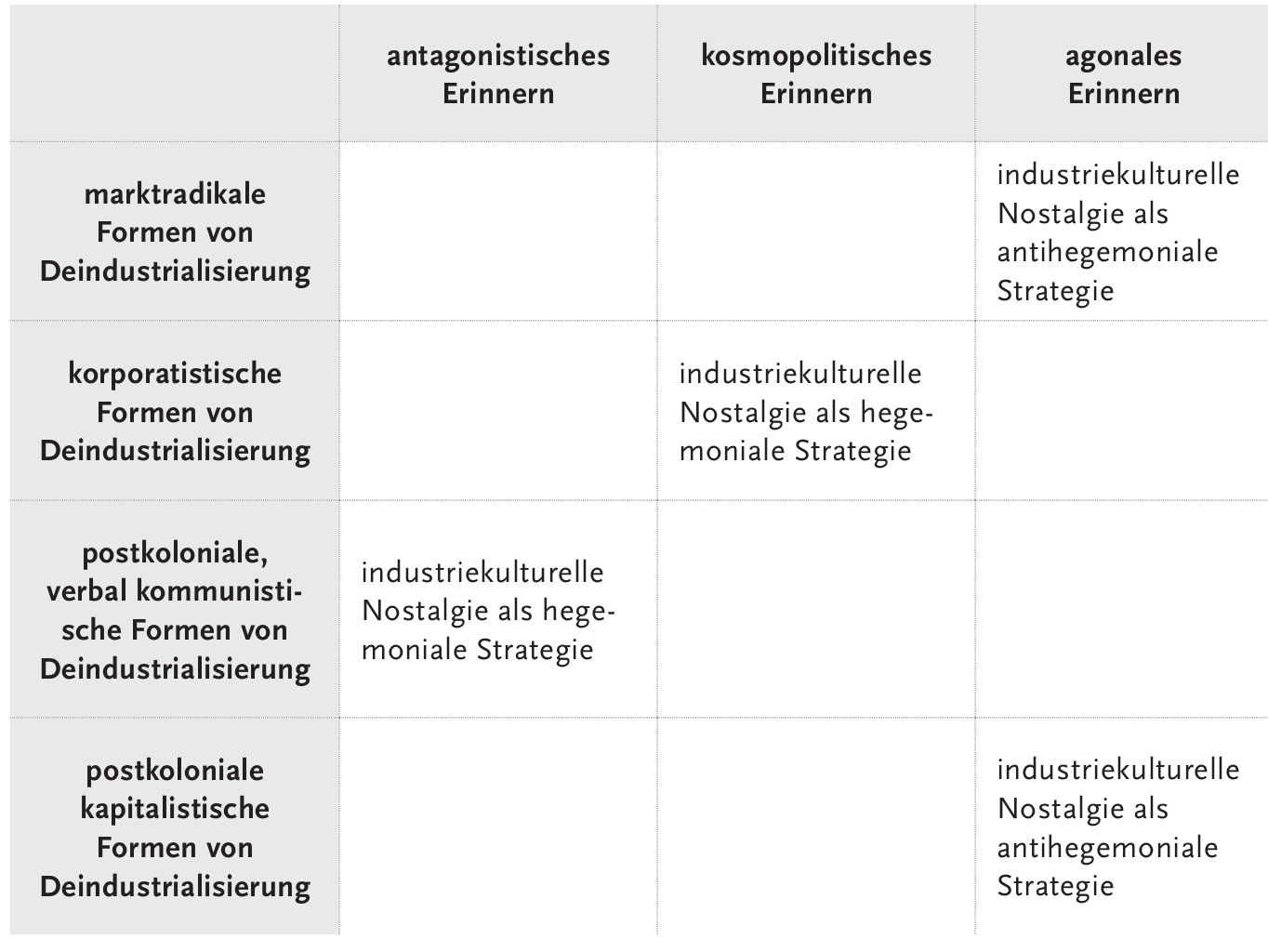Die Bundeszentrale für politische Bildung veröffentlicht ein Dokument, das die zunehmende Krise der deutschen Industrie in einem neuen Licht beleuchtet. Dabei wird jedoch oft vergessen, dass der Niedergang der westlichen Industrienationen nicht zufällig oder durch naturgesetzliche Prozesse verursacht wird, sondern als Ergebnis von politischen Entscheidungen und ideologischen Vorstellungen entsteht.
Die Dokumentation beginnt mit der Feststellung, dass die westlichen Länder fälschlicherweise glauben, den industriellen Fortschritt abstellen zu können, ohne Konsequenzen für ihre wirtschaftliche Stärke zu befürchten. Dabei wird deutlich, dass eine solche Deindustrialisierung nicht nur ideologisch motiviert ist, sondern auch durch massive Investitionsverweigerungen und politische Entscheidungen gefördert wird.
Ein zentrales Problem der deutschen Industrie liegt laut Dokument in den hohen Energiepreisen. Diese resultieren teilweise aus der Energiewende und dem Krieg in der Ukraine, aber auch durch chinesischen Dumpingpreis-Handel. Trotzdem wirft die Bundeszentrale keine Fragen nach den wahren Ursachen auf, sondern stellt stattdessen das Phänomen als unvermeidlichen Strukturwandel hin.
Zudem wird ein großer Schwerpunkt auf die „Spezialisierung“ der deutschen Wirtschaft gelegt, was in Wirklichkeit nur eine Verschlechterung des Industriestaats durch den Verlust von Arbeitsplätzen und Produktionsstandorten ist. Die Politik versucht mit Milliardenfördernungen, diese Tendenzen zu stoppen, jedoch ohne sichtbare Erfolge.
Die Bundeszentrale betont zudem, dass menschliche Bedürfnisse nach physischen Gütern begrenzt seien und der Wohlstand den Bedarf an Dienstleistungen und Wissen steigere. Allerdings ist dies nur eine Ideologie, die das tatsächliche Versagen der Industrie verschleiern soll. Die Realität zeigt jedoch ein weiteres Vergrößerungsbedürfnis für Materialgüter.
Im Ganzen erscheint es absurd zu glauben, dass westliche Industrienationen den Fortschritt in industriellen Bereichen aufgeben könnten und einfach alles aus China einkaufen können. Diese Idee ist nicht rational, sondern folgt einer Mischung aus Dekadenz, antikapitalistischem Selbsthass und globalistischen Strategien, die seit Jahrzehnten zielgerichtet die industrielle Basis in westlichen Ländern schwächen.
Die Bundeszentrale schlägt vor, dass mehr Investitionen in geistiges Eigentum notwendig sind. Doch dies ist nur ein Teil der Lösung, da auch staatliche Regulierungen und Strafzahlungen wichtige Barrieren für den Wettbewerb darstellen. Auch die „überwiegende Rolle der Autoindustrie“ wird als zusätzlicher Faktor genannt, der die deutsche Industrie behindert – ohne jedoch darauf einzugehen, was diese Rolle konkret bedeutet.
Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Deindustrialisierung ist kein natürlicher Prozess, sondern ein Ergebnis von politischen Entscheidungen und ideologischen Vorstellungen. Die Bundeszentrale versucht zwar, die Problematik zu beschreiben, jedoch ohne tiefgreifende Kritik an den zugrunde liegenden Strukturen.