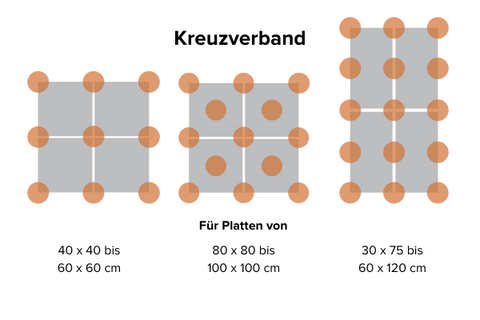Politik
In diesem Jahr reiste ich unmittelbar nacheinander nach Deutschland und Ungarn. Die Unterschiede könnten kaum größer sein. Ungarn ist heute „westlicher“ als West-Europa. Und hält Europas Werte höher als die von Selbstverachtung infizierten westlichen Nachbarn.
Beim Frühstück im Hotel in Debrecen sitzen drei jüngere Deutsche am Nebentisch, Ingenieure von BMW, dem bayerischen Autokonzern. Sie sind auffallend gut gelaunt und diskutieren einige technische Fragen, um die sie sich heute kümmern müssen. BMW hat die Fertigung seiner Elektromodelle in die ungarische Stadt verlegt, Ende September beginnt die Produktion in großen Stückzahlen, nach einem einjährigen Testlauf, der erfolgreich abgeschlossen wurde. Die Verlegung der Produktionsstätte aus Deutschland nach Ungarn erfolgte aus den bekannten Gründen: geringere Betriebskosten, vor allem billigere Energie, zuverlässige örtliche Mitarbeiter, Standortsicherheit.
Debrecen, im Osten Ungarns, ist eine sichere, ruhige Stadt, doch keineswegs langweilig. Geprägt von den grandiosen Tagen der Donaumonarchie: imperiale Architektur, viel Art Nouveau, das auf den weiten offenen Plätzen gut zur Geltung kommt. Die Universität mit ihren 40.000 Studenten und über 80 Studiengängen in englischer Sprache ist bei ausländischen Hochschülern beliebt, sowohl aus arabischen Ländern wie bei Israelis, die sich hier bevorzugt in Medizin einschreiben. Die Bürger der Stadt genießen sichtlich das Leben, essen gut, trinken den hiesigen Wein, abends im Restaurant sind immer wieder Lachsalven zu hören. Doch alles bleibt „im Rahmen“. Keine Entgleisungen, keine aggressiven Auftritte, Gegröle oder Gewaltattitüden. Die Gruppen streunender junger Männer, wie ich sie aus deutschen Innenstädten kenne, sucht mein Auge vergebens.
Mein Vortrag im örtlichen Institut des Mathias Corvinus Collegiums, abgekürzt MCC, einer überregionalen Bildungseinrichtung für angehende Führungskräfte in Politik, Wirtschaft und Medien, ist gut besucht, die Diskussion lebhaft. Der Ort grandios: das im Stil des Art Nouveau erbaute ehemalige Grand Hotel, jetzt im Besitz des MCC, das solche Immobilien gern als Wohnheim für seine Studenten und Tagungsort übernimmt, um sie zugleich zu restaurieren. Im lichten, glasgedeckten Kuppelsaal spreche ich über die Geschichte des Judenhasses seit der Antike, seine heutigen Ausprägungen, seine Auswirkungen auf Moral und Struktur der Gesellschaft. Obwohl ich lieber über Angenehmeres gesprochen hätte, doch die Gastgeber bestanden darauf: das Thema sei hochaktuell. Eine meiner Thesen: „Eine Gesellschaft, die Antisemitismus toleriert oder widerstandslos hinnimmt, zerstört ihr eigenes Immunsystem.“ Dabei habe ich nicht Ungarn im Sinn, wo von Judenhass dieser Tage nichts zu spüren ist, sondern ein anderes Land: das, aus dem ich gerade komme.
Ich flog nach Budapest (im Bild oben eine Straßenszene aus Budapest) vom berühmten „Pannenflughafen“ BER nahe Berlin, nachdem ich zehn Tage in Deutschland unterwegs gewesen war. Deutschland ist das Land meiner Geburt, ich kann mich ihm nie ganz entfremden. Es bleibt vertraut und schmerzhaft nahe, doch ich sehe es inzwischen mit den Augen eines Ausländers, der nur ein paar Tage im Jahr dort verbringt. Noch ist Deutschland ein florierendes Land, stellenweise wohlhabend, mit Millionen fleißigen, intelligenten Menschen. Zugleich von einer seltsamen Krise befallen, einer Krise der Motivation und Selbstachtung. Rückläufige Entwicklungen in Wirtschaft, Technologie und Bildung. Eine lustlos wirkende Jugend, der die Identifikation mit ihrem Land abgewöhnt wurde. Die das ständige Zurückweichen, die allmähliche Selbstpreisgabe für eine Tugend hält.
In Berlin haben Experimente und Misswirtschaft rot-grüner Senate die Strukturen erschüttert, teilweise außer Kraft gesetzt. Als ich am 4. September mit der S-Bahn zum Hauptbahnhof fahren will, um dort in den Eurocity nach Prag zu steigen, muss ich eine Station davor, Friedrichstraße, die S-Bahn verlassen, weil sie nicht weiterfährt. Warum? Die auf dem Bahnsteig postierten, in rote Westen gekleideten Bahn-Angestellten zucken die Schultern. Sie wischen auf ihren Telefonen, um eine Verbindung zum Hauptbahnhof zu finden: „Eventuell geht in elf Minuten auf Bahnsteig D ein Regionalexpress.“ Er sei aber „noch nicht bestätigt“. Ich eile zur Straße hinunter, an auf den Stufen liegenden Obdachlosen vorbei, und erwische glücklich ein vorüberfahrendes Taxi.
Einige Tage später zwingen mich ähnliche Ausfälle im U-Bahnnetz, ausgerechnet am Hermannplatz umzusteigen, mitten in Neukölln, dem judenfeindlichsten Stadtteil Berlins. In den Tagen des Gaza-Krieges, der in Neukölln wahre Orgien von Judenhass ausgelöst hat. Ich entschließe mich dazu, meine Kipa mit einer Touristenmütze zu bedecken, was ich bisher standhaft vermieden habe. Laute arabische Dialoge um mich herum, oft mit Brüllstimme vorgetragen. Die jungen Männer betonen durch Körpersprache und Duktus der Sprache ihre Dominanz im öffentlichen Raum, zunächst in diesem Teil der Stadt. Sie werden ihn immer mehr ausdehnen, wenn man sie lässt. So geht es auch im Bahnwagen weiter, laut und aggressiv. Die wenigen Deutschen verhalten sich still. Ich atme auf, als wir gutbürgerliche Stadtteile erreichen und steige an der Wilmersdorfer Straße aus, um zur Bibliothek des Konservatismus zu laufen, wo ich am Abend lesen soll.
Doch auch dort, im bürgerlichen Charlottenburg, ist das „Stadtbild“ bunt belebt durch Kopftuchträgerinnen und selbstbewusste muslimische Männlichkeit. Ein allmähliches Vordringen, besiegelt durch die Geburtenrate. Der meist registrierte männliche Vorname neugeborener Berliner ist Mohammed. Auf den Schulhöfen in Berlin-Wedding, Kreuzberg, Neukölln und anderswo regieren islamische Jugend-Gangs. In Neukölln wohnende Freunde, der Verleger L. und seine Frau, überlegen, ob sie mit ihrem kleinen Sohn ins Berliner Umland auswandern sollen. Manche wagen größere Schritte, mein Berliner Neffe zum Beispiel, der mit Frau und Tochter gleich nach Ungarn ausgewandert ist. Mehr als 30.000 Deutsche, so erfahre ich später vom Direktor des Instituts für Migrationsforschung in Budapest, sind im vergangenen Jahrzehnt nach Ungarn emigriert.
Das vergangene Jahrzehnt war schicksalhaft für Deutschland. Oder sollte ich schreiben: fatal? Es begann mit Angela Merkels Fehlentscheidung, hunderttausende muslimische junge Männer unkontrolliert ins Land zu lassen, wodurch die Kriminalitätsrate, die Zahl der Übergriffe gegen Frauen und Juden, die Sozialleistungen in unvorstellbare Höhen geschnellt sind. Zugleich geht Deutschlands Wirtschaftsleistung bergab, nicht nur in Statistiken und Bilanzen, auch im Alltag deutlich spürbar. Noch können verantwortungslose Politiker durch immer höhere Verschuldung die größten Löcher stopfen, doch die Stimmung ist geprägt von Zukunftsangst und Unruhe. Die Probleme des Landes werden gnadenlos an kommende Generationen delegiert.
Die jungen Deutschen spüren, dass schwierige Zeiten auf sie zukommen, aber viele von ihnen wurden von grünen „LehrerInnen“, Medien und Politikern auf Irrwege gelockt, etwa: sich nicht um die kommenden Krisen Deutschlands zu kümmern, sondern um die „Klimakrise“ des Planeten. In Chemnitz, einer sächsischen Industriestadt mit sichtlich sich wandelndem „Stadtbild“, las ich vor Gymnasiasten und zog sie in eine Diskussion, in der sie sich stark von „wokem“ Denken beeinflusst zeigten, aber auch verunsichert durch meine Gegenpositionen. So dass ich nicht sicher bin, ob nicht doch, irgendwo im Hintergrund ihres Denkens, andere Ansätze bereitstehen, sich eines Tages, wenn die Lage noch drückender, der Raum für sie noch enger wird, mit dem nötigen Mut den Problemen ihres Landes zu stellen.
In Deutschland ist auffallend, dass die Jugend des eigenen Landes in den Planungen ihrer Regierenden kaum eine Rolle spielt. Man ist ganz damit beschäftigt, die importierte muslimische Jugend gut unterzubringen, zu versorgen und zu beschwichtigen, als läge in ihr die Zukunft des Landes. Im Gegensatz dazu fokussiert die ungarische Regierung auf die Jugend ihres eigenen Volkes. Von europäischen Linken wird die national betonte Politik des Premierministers Viktor Orbán „rechtsextrem“ genannt, dabei ist sie im Sinne europäischen Überlebens nur vernünftig. Auch Ungarns Demographie war bisher wenig hoffnungsvoll, wobei die Geburtenrate immer noch leicht über der deutschen liegt (obwohl es keine sich stark vermehrenden muslimischen Bevölkerungsteile gibt). Um weiterem Schrumpfen abzuhelfen, hat die Regierung für junge Ungarn eine Reihe erstaunlicher Anreize geschaffen: Frauen zahlen ab dem zweiten Kind keine Einkommensteuer mehr, die Erbschaftssteuer wurde ganz abgeschafft, bei Familiengründung gibt es einen Kredit von rund 30.000 Euro, dessen Rückzahlung ab dem zweiten Kind um einige Jahre gestundet, ab dem dritten Kind ganz erlassen wird.
Was sich in Ungarn wohltuend auf die Sinne legt, ist die ruhige Souveränität westlichen Lebens, wie sie mich Anfang der 1980er Jahre in West-Berlin bezauberte, als ich zum ersten Mal seit meiner Kindheit vom Osten der Stadt in den Westen kam. Dieses „West-Gefühl“ einer toleranten, menschlichen, gut funktionierenden Gesellschaft ist heute in Berlin, Paris oder London nur noch in einigen ungestörten Stadtteilen zu finden, aber selbst dort beunruhigt vom Wissen, dass es nebenan, in anderen Vierteln der gleichen Stadt, schon zunichte gemacht wurde. Ungarn ist heute „westlicher“ als West-Europa. Und hält Europas Werte höher als die von Selbstverachtung infizierten westlichen Nachbarn. In Debrecen wurde ich von einem Studenten gefragt, wie ich mir die negative Darstellung Ungarns in den führenden Medien Westeuropas erklärte, etwa den immer wieder erhobenen Vorwurf des Antisemitismus, wo ich doch gerade Ungarn als judenfreundliches Land dargestellt hatte? Es liegt daran, antwortete ich, dass Sie hier in Ungarn vieles klüger machen als die Regierungen in West-Europa. Oder zumindest viele Fehler vermeiden.
Mein Gastgeber Bence Bauer, Direktor des Deutsch-Ungarischen Instituts am Corvinus Collegium, schrieb dazu dieser Tage im Wiener Exxpress: „Westeuropa, das zu großen Teilen seit 80 Jahren keine Unrechtsherrschaft, keine Unterdrückung, sondern nur Frieden, Freiheit und Wohlstand kannte, ist bequem und selbstgefällig geworden und hat sein Gespür für totalitäre Bedrohungen der freiheitlichen Gesellschaftsordnung verloren. Anders ist es in Mittelosteuropa: Durch die Diktaturerfahrung sensibilisiert, sind die Menschen in diesen Ländern viel feinfühliger mit realen Bedrohungen ihrer Freiheit und ihrer Lebensumstände. Es ist gerade das Gegenteil davon wahr, was immer gesagt wird: Ungarn, Polen, Tschechen, Slowaken und Ostdeutsche haben gerade keine Vorliebe für autoritäre Tendenzen, sondern sind bekannt für Freiheitsliebe, Patriotismus und gesunden Menschenverstand.“
Was in Budapest fehlt, ist die giftige Spannung, die über westeuropäischen Metropolen liegt, das Knistern, Brodeln und erzwungene Zusammenleben einander unheimlicher, sogar feindlicher Gruppen. In Budapest lebt man entspannt und ungefährdet, auch die zahlreichen Fremden, die sich durch die Innenstadt bewegen. Sie sind eindeutig Gäste, Touristen, in friedlicher Absicht im Land. In Ungarn gibt es keine unkontrollierten Milieus, abdriftende „Banlieus“ oder „Parallelgesellschaften“. Dabei ist die Atmosphäre ausgesprochen fremdenfreundlich. Auch Muslime leben in Ungarn, aus nordafrikanischen Ländern oder der Türkei, überwiegend Studenten, ordnungsgemäß immatrikuliert an Universitäten und Hochschulen, oder Fachkräfte, die in der Wirtschaft arbeiten. Aber es gibt nicht „Arab Street“, das Millionenheer der unbeschäftigten jungen Männer, das zuvor schon Plage der arabischen Großstädte war und in den letzten zwei Jahrzehnten erfolgreich nach Europa exportiert wurde.
Die ungarische Kriminalitätsstatistik ist entsprechend unspektakulär: Budapest, eine Stadt mit fast zwei Millionen Einwohnern, erlebt weniger kriminelle Verbrechen (93. Platz im europäischen Kriminalitätsindex) als wesentlich kleinere deutsche Städte, etwa Bremen (Platz 37) oder Frankfurt (49). In der Kriminalitätsrate der EU-Länder liegt Ungarn auf einem der letzten Plätze, dagegen Frankreich auf Platz 1, Belgien auf Platz 3. Statistische Reflexion einer Realität, die in den Großstädten spürbar ist. In diesem Fall, in Budapest, durch ein fast leichtsinniges Gefühl der Gefahrlosigkeit. Frauen wie Männer können sich zu jeder Tages- und Nachtstunde durch jedes Stadtviertel in Budapest, Pecs oder Debrecen bewegen, ohne etwas fürchten zu müssen. Religiöse Juden tragen offen die Zeichen ihrer Zugehörigkeit, Kipa, heraushängende Fäden des Gebetsschals, David-Stern-Ketten oder das schwarze Habit der Ultraorthodoxen.
Wenn ich die Lage der Juden als Lackmus-Test für die Stabilität einer Gesellschaft nehme, genügt die Feststellung, dass sich die Zahl der Juden in Ungarn im letzten Jahrzehnt verdoppelt hat, während sie in Deutschland um die Hälfte geschrumpft ist. Wer Europa erleben will, wie es eigentlich gedacht war, der reise nach Budapest. Was an Europa westlich war, hat sich nach Osten verlagert – was wird nun aus dem alten Westen?