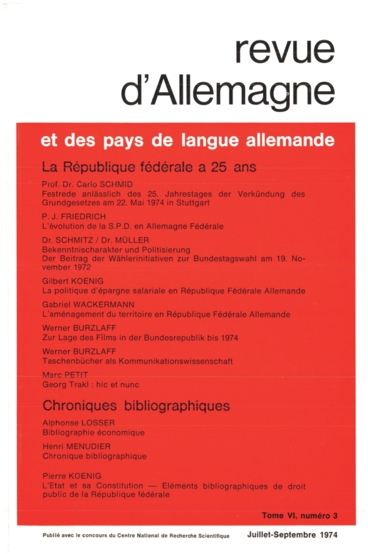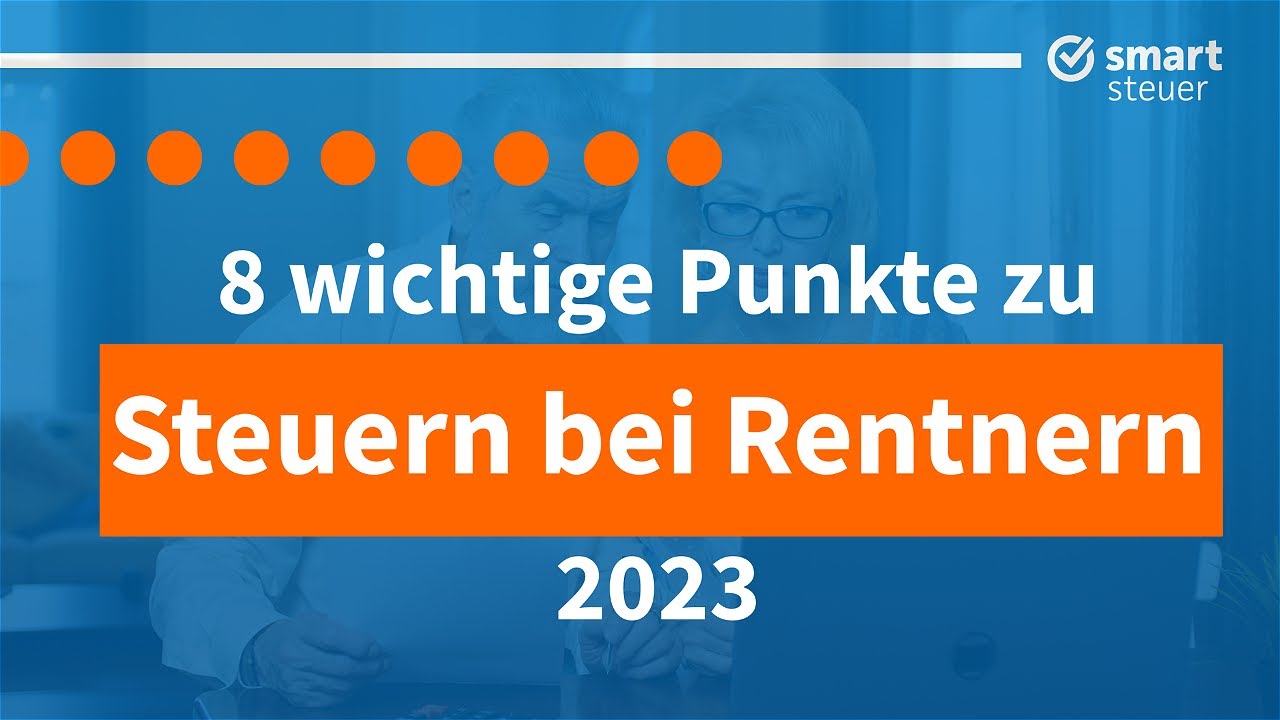Die wirtschaftlichen Lösungsansätze der Parteien im Wahlkampf
Berlin. Die Unterstützung für deutsche Unternehmen, die in eine schwierige Lage geraten sind, stand an oberster Stelle im aktuellen Wahlkampf. Die Konzepte der einzelnen Parteien durchlaufen teils deutliche Differenzen.
Gegenwärtig leidet die deutsche Wirtschaft unter erheblichen Herausforderungen. Hohe Energiepreise sowie eine beträchtliche Steuer- und Sozialbelastung setzen den Unternehmen zu. Auch die als übertrieben empfundene Bürokratie und langwierige Planung- und Genehmigungsverfahren stellen eine Belastung für den Wirtschaftsstandort Deutschland dar. Während für 2024 eine Stagnation der Wirtschaftsbremse prognostiziert wird, wird für 2025 lediglich ein minimaler Anstieg erwartet. Die Parteien präsentieren nun ihre Pläne, um die Wirtschaft auf Kurs zu bringen. Hier eine Übersicht.
Die Sozialdemokraten setzen auf die Wiederbelebung der Wirtschaft durch gezielte Investitionen in zukunftsträchtige Technologien sowie durch sozial ausgewogene Maßnahmen. Ein zentrales Element in ihrem Ansatz ist der Deutschlandfonds, der auf bis zu 100 Milliarden Euro angelegt werden soll mit dem Ziel, Innovationen in den Bereichen Klimaschutz, Digitalisierung und Infrastruktur voranzubringen. Dieser Fonds soll sowohl öffentliche als auch private Mittel mobilisieren und nachhaltige Arbeitsplätze kreieren.
Darüber hinaus wurde der „Made in Germany“-Bonus ins Leben gerufen, der Unternehmen, die in grüne Technologien und nachhaltige Produktionsverfahren investieren, steuerliche Vorteile gewährt. Dies soll den notwendigen Strukturwandel unterstützen und die Wettbewerbsfähigkeit verbessern. Laut dem Wahlprogramm strebt die SPD an, jährlich Investitionen von 20 Milliarden Euro zu initiieren.
Des Weiteren plant die SPD Steuererleichterungen für kleine und mittelständische Unternehmen. Die Körperschaftsteuer soll gesenkt werden, um die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und Anreize für Investitionen zu setzen. In ihrem Programm wird betont: „Wir wollen die Entlastung des Mittelstands als Motor des Wirtschaftswachstums vorantreiben.“ Diese Maßnahmen sollen den wirtschaftlichen Rahmen langfristig stabilisieren und zukunftssichere Arbeitsplätze schaffen.
Die Union verfolgt drei zentrale Schwerpunkte zur Stärkung der deutschen Wirtschaft: Steuererleichterungen, Bürokratieabbau und die Förderung von Investitionen in zukunftsfähige Technologien. Die Abschaffung des Solidaritätszuschlags für alle Steuerzahler steht dabei im Fokus, insbesondere zur Entlastung des Mittelstands und der Bürger. Durch diese Maßnahme wären jährlich Rund zehn Milliarden Euro an Entlastungen zu erwarten, was die Kaufkraft steigern würde.
Ein weiterer Punkt in ihrem Programm ist die dauerhafte Senkung der Mehrwertsteuer auf sieben Prozent für Lebensmittel im Gastgewerbe, um die Branche nach der Corona-Pandemie zu unterstützen und Arbeitsplätze zu sichern. Dies würde den Gastronomieunternehmen jährlich um zwei Milliarden Euro Erleichterung bringen.
Zudem möchte die Union Investitionen in Digitalisierung und Infrastruktur anregen und plant steuerliche Anreize für Unternehmen sowie eine Reduzierung von bürokratischen Hürden. Ihr Ziel ist es, die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands langfristig zu sichern: „Mit einer starken Wirtschaft schaffen wir Wohlstand und sichere Arbeitsplätze für alle.“ Eine Wachstumsrate von zwei Prozent wird angestrebt, welche zuletzt auch in einer neuen „Agenda 2030“ erläutert wurde.
Die Grünen setzen sich mit ihrem Programm unter dem Motto „Zusammen wachsen“ für eine wirtschaftliche Neuausrichtung ein. Ein Vorschlag ist die Einführung einer fünfjährigen, unkomplizierten Investitionsprämie von zehn Prozent, die für alle Unternehmen gilt, ausgenommen Gebäudeinvestment. Darüber hinaus fordern sie den Deutschlandfonds, der zur Sanierung von Schulen, Kitas und Bahninfrastruktur verwendet werden soll. Der Finanzbedarf wird auf einen dreistelligen Milliardenbereich geschätzt. Eine Reform der Schuldenbremse wird ebenfalls angestrebt. Dabei sind neue Steuerformen im Gespräch, wie etwa eine globale Milliardärsteuer oder eine gerechtere Erbschaftssteuer.
Die FDP unter Christian Lindner fokussiert sich auf einen Abbau der Bürokratie, Steuersenkungen und eine Technologieoffenheit für die Rückkehr einer dynamischen Wirtschaft. Ein Kernstück ihres Vorschlags ist das Easy-Tax-Modell, das eine vereinfachte Steuererklärung für kleine und mittelständische Unternehmen vorsieht und somit jährlich sechs Milliarden Euro an bürokratischen Kosten einsparen könnte.
Außerdem plant die FDP ein Bürokratie-Moratorium, um die Einführung neuer bürokratischer Auflagen für mindestens zwei Jahre zu stoppen und dadurch Firmen zu entlasten. Technologische Offenheit ist ebenfalls ein wichtiges Anliegen, insbesondere durch steuerliche Anreize für KI und umweltfreundliche Technologien.
Die AfD setzt stark auf Deregulierung, fordernd einheitlichere Steuer- und Abgabensätze sowie die Reduzierung des bürokratischen Aufwands. Ein zentraler Punkt ist die Abschaffung des Solidaritätszuschlags und eine erhebliche Senkung der Sozialversicherungsbeiträge, die die Lohnnebenkosten drücken soll. Auch eine einheitliche Mehrwertsteuer von sieben Prozent für Gastronomie wird gefordert, sowie die Abschaffung von Luftverkehrs- und Ticketsteuern.
In ihrem Ansatz betont die AfD die starke nationale Wirtschaft und sieht die Notwendigkeit, die Bürokratie zu reduzieren und EU-Vorschriften zurückzunehmen, um den Standort Deutschland zu stärken. Eine Förderung bestimmter Technologien wird skeptisch betrachtet. „Staatliche Entscheidungen können dem Markt oft nicht standhalten“, wird im Programm formuliert.
Die Linke spricht sich für eine Umgestaltung der Wirtschaft aus, die Arbeitsplätze schützt anstatt nur Profit zu schaffen. Ihr Programm verlangt die Wiedereinführung einer Vermögensteuer und die Einführung einer speziellen Tax für Milliardäre. Des Weiteren sollen Privatjets und größere Yachten verboten werden.
Die Partei fordert eine sozialökologische Umgestaltung der Industrie, wobei rund 200 Milliarden Euro in einen Investitionsfonds fließen sollen. Die Gelder sollen an langfristige Arbeitsplatzgarantien und verbindliche Investitionspläne gebunden sein.
Schließlich fordert das Bündnis Sahra Wagenknecht eine umfassende Überarbeitung der Wirtschafts- und Energiepolitik. Ein Rückgriff auf langfristige Energiekaufverträge, die auf niedrigste Preise ausgerichtet sind, und ein Ausbau der Energienetze in staatliche Hände sind zentrale Forderungen, ebenso wie eine umfängliche Steuerreform.
Die Debatten darüber zeigen die unterschiedlichen Ansätze der Parteien zu den Herausforderungen der deutschen Wirtschaft auf.