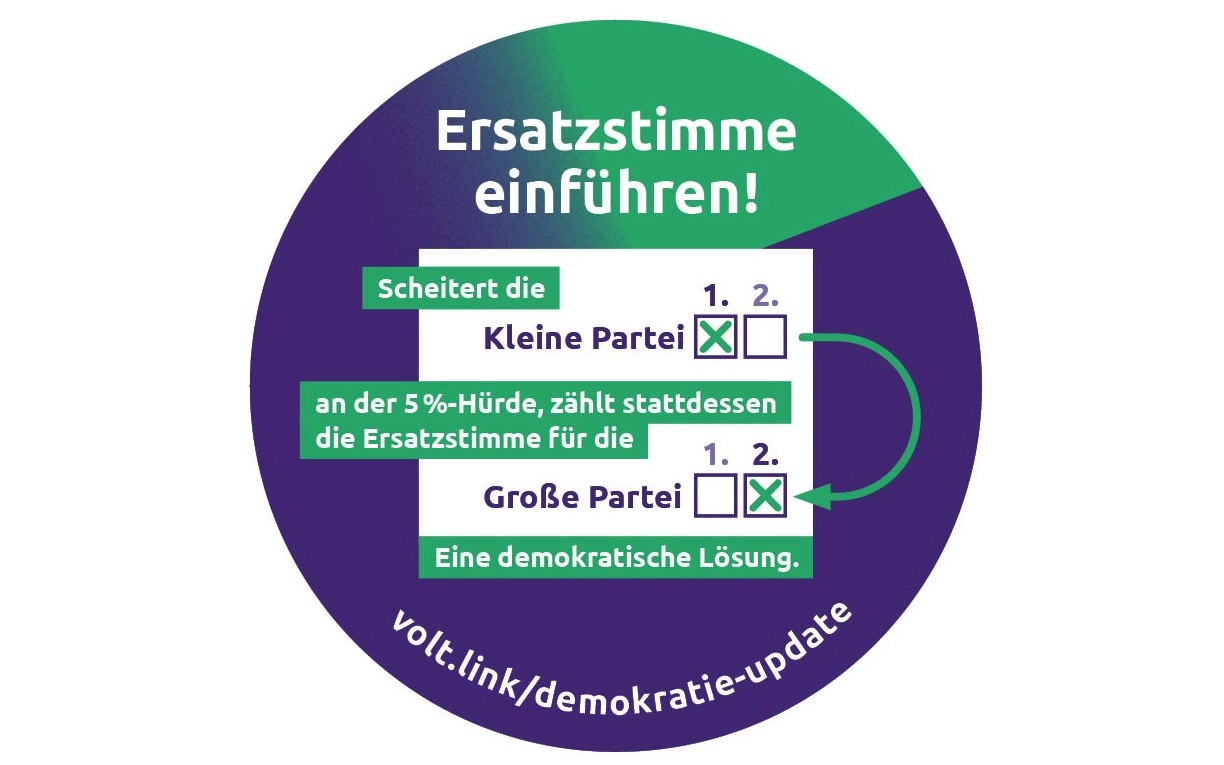Revolutionierung der Korruptionsregeln: Trumps Entscheidung zur Legalisierung von Bestechung
In Washington, D.C. manifestiert sich eine signifikante Wende in der amerikanischen Gesetzgebung. Präsident Donald Trump hat eine Anweisung an das Justizministerium herausgegeben. Dies führt dazu, dass Unternehmen künftig nicht mehr mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen müssen, wenn sie im Ausland Politiker und Beamte bestechen, um an gewinnbringende Verträge zu gelangen. Damit wird das fast 50 Jahre alte Gesetz „Foreign Corruption Practices Act“, das während der Watergate-Affäre in den 1970er Jahren eingeführt wurde, erheblich geschwächt.
Trump argumentiert, dass dieses Gesetz eine Barriere für die wirtschaftliche Entfaltung der Vereinigten Staaten darstellt, da es amerikanischen Unternehmen untersagt, Praktiken nachzugehen, die international verbreitet sind. Seiner Aussage nach gefährdet das Gesetz die Wettbewerbsfähigkeit US-amerikanischer Firmen. Er betont: „Wir müssen unser Land retten. Politische Maßnahmen sollten darauf abzielen, die amerikanischen Arbeiter, Familien und Unternehmen, unabhängig von ihrer Größe, zu unterstützen, um im globalen Wettbewerb bestehen zu können.“ Bei dieser Gelegenheit umschifft Trump explizit das Wort Bestechung und spricht von „üblichen Geschäftspraktiken in anderen Ländern“, die in den USA nicht länger geahndet werden sollten.
Diese Entscheidung hat jedoch bei einigen Politikern und Ethikern Bedenken ausgelöst. Senator Chuck Grassley, Vorsitzender des Justizausschusses, äußerte sich kritisch: „Wir haben Gesetze erlassen, die hohe moralische Standards im internationalen Handelsverkehr erfordern, und es ist wichtig, dass wir diese Standards wahren.“ Die Reaktion der Wirtschafts-Ethiker in Washington war alarmiert und sie bezeichneten die Reform als ein gefährliches Signal, das jahrzehntelange Fortschritte zunichtemachen könnte.
Die Vorgeschichte zu diesem Thema liegt in den Ergebnissen der US-Börsenaufsicht SEC, die vor vielen Jahren entdeckte, wie zahlreiche Unternehmen schwarze Kassen führten und über 400 US-Firmen dabei identifizierte, die 300 Millionen US-Dollar an ausländische Beamte gezahlt hatten, um lukrative Geschäfte abzuschließen. Mit dem Gesetz, das nun durch Trump in Frage gestellt wird, wurden viele Unternehmen strafrechtlich verfolgt und mit teilweise hohen Geldbußen belegt.
Namhafte Unternehmen wie Goldman Sachs sahen sich beispielsweise mit Vorwürfen konfrontiert, mehr als eine Milliarde US-Dollar an Beamte in Malaysia und den Vereinigten Arabischen Emiraten zur Erlangung von Aufträgen zu überweisen. Das Unternehmen einigte sich in einem Vergleich, was fast drei Milliarden Dollar kostete. Auch der deutsche multinational tätige Konzern Siemens wurde vor 17 Jahren für das Fälschen von Geschäftsdokumenten in mehreren Ländern zur Kasse gebeten und zahlte damals ein Bußgeld von 800 Millionen Dollar an die USA.
Die Entscheidung von Trump festigt den Trend der Abkehr von etablierten Anti-Korruptionsrichtlinien. Letztlich wies er auch an, ein Strafverfahren gegen den amtierenden Bürgermeister von New York, Eric Adams, zu beenden, der wegen Betrug und Bestechung in Verbindung mit türkischen Beamten angeklagt war. In diesem Kontext sieht man, dass Trumps Vorgehen sich als Teil einer insgesamt umfassend neuen Strategie präsentiert.