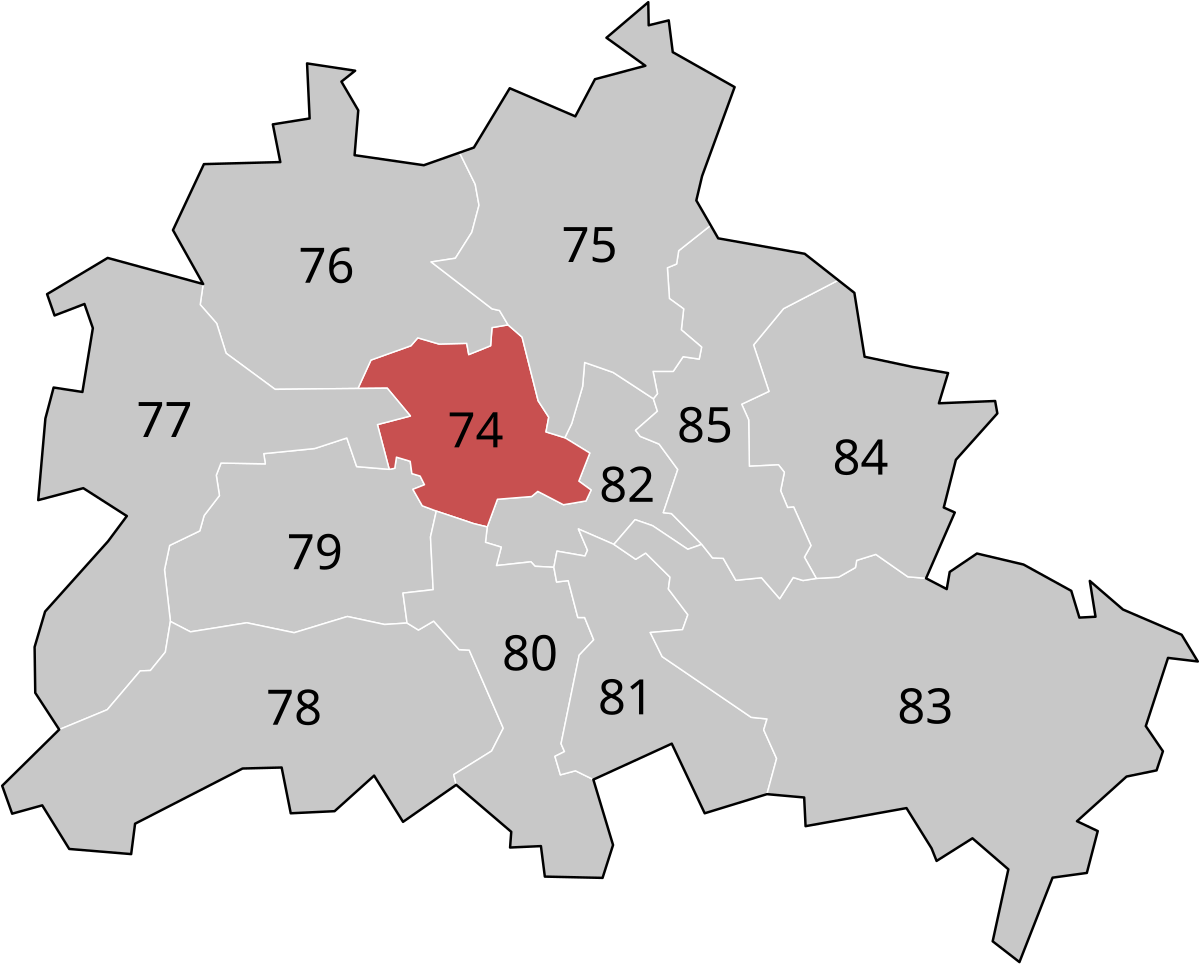Blick auf die politische Diskussion: Gefährdet eine mögliche AfD-Machtübernahme die Demokratie in Deutschland?
In der aktuellen politischen Diskussion in Deutschland wird oft behauptet, die Demokratie sei in Gefahr. Ein möglicher Wahlsieg der AfD könnte demnach bedeuten, dass nationale sozialistische Strömungen wieder Einzug halten. Doch was steckt wirklich hinter diesen Ängsten?
Die nationalsozialistische Bewegung war bekannt dafür, das Parlament zu missachten und mit der Angst der Bevölkerung zu spielen. Ihre Strategie beinhaltete die Ausgrenzung politischer Gegner, beginnend in den parlamentarischen Gremien und schließlich auf gesellschaftlicher Ebene – ein tragischer Verlauf, der letztendlich in einem Massenmord endete. Die Gewalt war das Mittel, mit dem diese Bewegung gestoppt werden konnte.
Das Grundgesetz hat zur Aufgabe, die individuelle Freiheit zu wahren. In einer vielfältigen Gesellschaft besteht das Risiko, dass unterschiedliche Ansichten aufeinandertreffen – die Toleranz von Meinungen, die man möglicherweise nicht gutheißt, ist demnach gefragt. Vielfalt bedeutet, die eigene Unbehaglichkeit in einer bunten Gemeinschaft aushalten zu können.
Der Begriff „Parlament“ hat seinen Ursprung im Französischen „parler“, was „sprechen“ heißt. Die Idee des Parlaments besteht darin, dass Vertreter verschiedener politischer Überzeugungen miteinander kommunizieren. Selbst der Dialog mit extremen Parteien ist legitim, denn Gespräche sind die friedlichste Form der Konfliktbewältigung.
Wenn jedoch die Kommunikation abbricht, wird über die anderen gesprochen – oft missfällig und von Angst geprägt. Dies führt zu einer verzerrten Wahrnehmung des politischen Gegners. In solchen Momenten besteht die Gefahr, dass die eigene Abneigung gegen diese Gruppen in gewaltsame Handlungen umschlägt. Dies war auch ein Grund, warum die Nationalsozialisten das Parlament verachteten und zur Ausgrenzung aufriefen.
In einer freien Gesellschaft haben alle Bürger das Recht, unabhängig von ihrer politischen Weltanschauung im Parlament Gehör zu finden. Der Grundsatz, dass unterschiedliche Meinungen und sogar extreme Überzeugungen diskutiert werden dürfen, ist zentral. Jede Meinung sollte kritisch hinterfragt und in den Diskurs eingebracht werden, denn die Macht, andere Ansichten zu verbieten, führt nur zu Missbrauch.
Bei der Formulierung von Gesetzen sollte immer in Betracht gezogen werden, ob man gleichermaßen mit diesen Regelungen leben kann, wenn andere politische Gruppierungen an der Macht sind. Ein Nein auf diese Frage sollte zur Überdenkung des Gesetzes führen.
Ein kritischer Punkt wird erreicht, wenn eine Mehrheit der Bürger so viel Angst hat, dass sie die Verfassung in Frage stellt und verfassungswidrige Methoden anwendet, um unliebsame politische Parteien aus dem Diskurs zu drängen.
Über die Absicht derjenigen zu spekulieren, die den Dialog verweigern und stattdessen Mauern errichten, führt zu beunruhigenden Fragen. Welche Maßnahmen wären sie bereit zu ergreifen, wenn die von ihnen gefürchteten Gruppen an Stärke gewinnen? Wären sie bereit, Gewalt einzusetzen, um diese Mauern zu schützen? Gerade in Anbetracht jüngster geschichtlicher Ereignisse, in denen die Nazis mit brutalen Mitteln gestoppt wurden, ist dies alles andere als trivial.
Die Debatte über die vermeintlichen Gefahren, die die Demokratie bedrohen, wird am kommenden Sonntag von Gerd Buurmann fortgeführt. Er wird mit Henryk M. Broder, dem Herausgeber der „Achse des Guten“, und dem Schriftsteller Giuseppe Gracia sprechen, der mit seinem Buch über den Antisemitismus auf eine große Bedrohung hinweist.
Die hier verwendeten Links zu Buchempfehlungen sind Affiliate-Links. Wenn Sie über diese Links einkaufen, unterstützt das die Plattform „Achgut.com“ – ohne Einfluss auf die berichteten Inhalte.