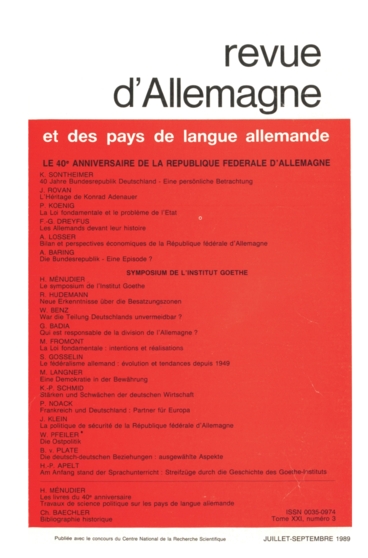Koalitionsverhandlungen im Fokus der Regierungsbildung
Berlin. Nach dem Abschluss der Bundestagswahl beginnt für die Parteien die entscheidende Phase der Regierungsbildung, in der sie sich in Koalitionsverhandlungen engagieren. Was während dieser Gespräche geschieht und warum sie einen so zentralen Stellenwert im demokratischen System Deutschlands haben, wird hier erläutert.
Die Auszählung der Millionen abgegebenen Stimmen ist abgeschlossen und nun steht das Ergebnis fest. Doch was passiert als Nächstes? Die Parteien müssen sich in Koalitionsverhandlungen zusammenfinden. Diese Gespräche führen zur Bildung von Koalitionen zwischen zwei oder mehr Parteien und sind notwendig, um eine Regierungsmehrheit zu schaffen, die dann den Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin wählt sowie ein Kabinett bildet.
Koalitionen sind vor allem dann unentbehrlich, wenn keine Partei bei der Bundestagswahl die absolute Mehrheit erzielt. Historisch gab es diese Ausnahme nur einmal: 1957 erlangte die Union 50,2 Prozent der Zweitstimmen, entschied sich jedoch dennoch zu einer Kooperation mit der Deutschen Partei, anstatt alleine zu regieren.
In den Koalitionsverhandlungen kommen die Spitzenpolitiker der beteiligten Parteien zusammen, um die politischen Rahmenbedingungen der gemeinsamen Regierungsarbeit zu besprechen. Dabei stehen häufig wichtige Fragen auf der Agenda: Welche politischen Ziele verfolgt jede Partei? Wer erhält welches Ministerium? Und welche Regeln soll es für die zukünftige Zusammenarbeit geben?
Am Ende dieses Prozesses resultiert ein Koalitionsvertrag, der die Vereinbarungen festhält. Üblicherweise wird solch ein Vertrag für die Dauer einer Legislaturperiode geschlossen, wobei Änderungen möglich sind, sofern sich die Partner einig werden. Die rechtliche Bindung dieser Verträge ist jedoch umstritten; sie sind nicht gerichtlich einklagbar, sondern gelten eher als politisch verbindliche Absprachen und fungieren somit als „Geschäftsgrundlage“ für die politisch arbeitende Regierung.
Die Parteien sind bestrebt, sich an die Koalitionsverträge zu halten, um öffentlich nicht als unzuverlässig oder loyalitätsbrüchig wahrgenommen zu werden. Ein Abweichen würde wahrscheinlich negative mediale Aufmerksamkeit nach sich ziehen und negative Konsequenzen für die Regierungsparteien haben.
Besonders langwierig waren die Koalitionsverhandlungen nach der Bundestagswahl von 2017, in denen die Union zunächst mit FDP und Grünen diskutierte. Nachdem die Liberalen die Gespräche abbrachen, trat die SPD in die Verhandlungen ein. Letztlich dauerte es 171 Tage, bis eine Regierung zustande kam.
Koalitionsverhandlungen und -verträge sind nicht nur ein Fundament für die Zusammenarbeit in der Regierung; sie sind auch ein Symbol für den demokratischen Prozess in Deutschland. Da in der Regel keine Partei genügend Zustimmung erhält, um alleine zu regieren, sind Kompromisse und Partnerschaften unerlässlich.
Die Parteien präsentieren sich als gleichwertige Partner, die unterschiedliche gesellschaftliche Strömungen, Meinungen und Haltungen repräsentieren müssen, um gemeinsam die Regierung zu führen. Während im Wahlkampf oft die Unterschiede im Vordergrund standen, steht nun das Finden von Gemeinsamkeiten im Fokus.
Darüber hinaus ermöglichen die Verhandlungen auch kleineren gesellschaftlichen Gruppen, ihre Anliegen in die Regierungspolitik einzubringen. Diese Praxis ist ein wesentlicher Bestandteil der Demokratie und garantiert politische Teilhabe.
Kritisch wird dabei oft die „Brandmauer“ der Mitte-Parteien zur AfD betrachtet. SPD, Grüne, FDP und, mit Einschränkungen, CDU/CSU, weigern sich, mit der teils rechtsextremen Partei zusammenzuarbeiten. Däuft oft als undemokratisch wahrgenommen, sehen die Mitte-Parteien die AfD als Bedrohung für die Demokratie an und rechtfertigen ihre Weigerung damit, dass die AfD selbst undemokratische Ansichten vertreten würde.