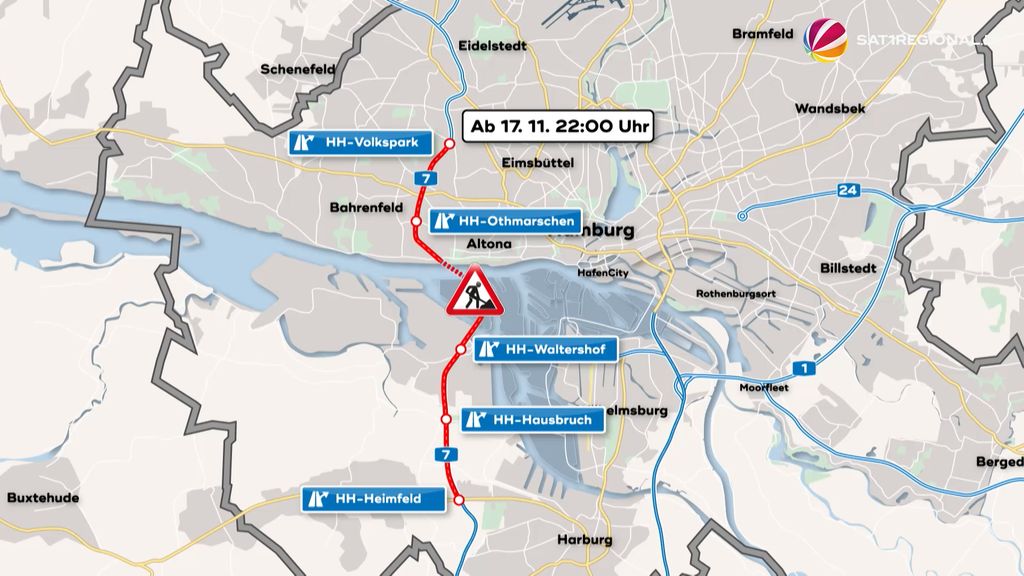Neues Wahlrecht für Berlin und Brandenburg: Auswirkungen und Herausforderungen
Die Bundestagswahl im Jahr 2025 bringt eine bedeutende Reform des Wahlrechts mit sich, die erstmals in Kraft tritt. Dies hat zur Folge, dass sich die Größe des Parlaments verringert, Überhang- und Ausgleichsmandate abgeschafft werden und die Bedeutung der Erststimmen abnimmt. In der Region könnte es für Wahlkreis-Sieger schwierig werden, tatsächlich einen Sitz im Bundestag zu ergattern, selbst wenn sie in ihrem Wahlkreis die meisten Stimmen erhalten.
Insgesamt sind rund 4,5 Millionen Bürgerinnen und Bürger in Berlin und Brandenburg zur Bundestagswahl am 23. Februar 2025 wahlberechtigt. Trotz des neuen Wahlrechts bleibt der Prozess am Wahltag unverändert: Die Wähler haben zwei Stimmen – eine für den Direktkandidaten und eine für die Partei. Allerdings wird die Zusammensetzung des Bundestages nun ausschließlich von den Zweitstimmen bestimmt, da die neuen Regelungen die vorherigen Überhang- und Ausgleichsmandate verbannen.
Ein neues Konzept, das im Rahmen dieser Wahlrechtsreform eingeführt wird, ist das sogenannte Zweitstimmendeckungsverfahren. Dieses besagt, dass Direktmandate aus den 299 Wahlkreisen nur dann vergeben werden, wenn sie durch das Zweitstimmenergebnis abgedeckt sind. Folglich ist es möglich, dass ein Direktkandidat, der in seinem Wahlkreis die meisten Stimmen erhält, dennoch keinen Platz im Bundestag bekommt.
Unabhängig von dieser Neuordnung ist bereits jetzt klar, dass im neuen Bundestag 630 Abgeordnete sitzen werden. Die Reform, die 2023 im Bundestag verabschiedet wurde, zielte darauf ab, die Anzahl der Abgeordneten zu reduzieren, da in der Vergangenheit eine Übergröße des Bundestags zu verzeichnen war. Zuletzt hatte die Anzahl der Abgeordneten die Zahl 736 überschritten, was mehr war als in Indiens größtem Parlament.
Die Abläufe zur Vergabe der Sitze werden so festgelegt, dass die 630 Mandate basierend auf dem Zweitstimmenergebnis proportional auf die Parteien verteilt werden. Anschließend erfolgt eine Zuteilung der Sitze unter den jeweiligen Landeslisten, basierend auf den Wahlergebnissen der einzelnen Bundesländer. Zuerst werden die Mandate den Wahlkreissiegern zugeteilt, bevor die verbleibenden Sitze an die Listenbewerber verteilt werden. Falls die Anzahl der Direktkandidaten einer Partei die Zahl der Mandate übersteigt, können einige Wahlkreissieger leer ausgehen.
Beispielsweise zeigt eine Musterberechnung der Bundeswahlleiterin auf, dass bei der Bundestagswahl 2021 unter den neuen Regelungen einige Wahlkreissieger der SPD in Brandenburg keinen Direktmandat erhalten hätten, obwohl sie alle Wahlkreise gewonnen hatten.
In der Hauptstadt Berlin fanden die bisherigen Wahlen ohne Überhang- und Ausgleichsmandate statt, was sich auch bei der kommenden Wahl voraussichtlich nicht ändern wird. Insgesamt treten bei der Wahl 29 Parteien an, darunter sind auch Parteien, die bereits 2021 im Bundestag vertreten waren. In Berlin werden zusätzlich sieben neue Parteien auf den Stimmzetteln stehen, während Brandenburg nur einen Neuling aufweist.
Trotz der zahlreichen Änderungen behält die Grundmandatsklausel, die sicherstellt, dass Parteien mit weniger als fünf Prozent der Zweitstimmen in den Bundestag einziehen können, solange sie mindestens drei Direktmandate gewinnen, weiterhin Gültigkeit – zumindest bis zu einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts.
Vor dem Hintergrund dieser Reform wird die Linke mit großem Interesse auf die Ergebnisse in den Wahlkreisen blicken, insbesondere in Treptow-Köpenick, wo der erfahrene Gregor Gysi erneut antreten wird.
Die Wahlrechtsreform und ihre möglichen zukünftigen Auswirkungen sind nun von zentraler Bedeutung für die bevorstehende Wahl und darüber hinaus. Bereits jetzt gibt es Stimmen, die eine Rücknahme der Reform durch die oppositionellen Unionsparteien fordern, die zusammen mit der Linken eine kritische Haltung gegenüber den neuen Regelungen einnehmen.
In Brandenburg sind zudem Anpassungen der Wahlkreise aufgrund der Bevölkerungsentwicklung angekündigt worden, ohne dass sie direkten Einfluss auf die Wahlrechtsreform haben. Insgesamt bleibt abzuwarten, wie sich die politischen Landschaften und das Wählerverhalten unter den neuen Bedingungen entwickeln werden.