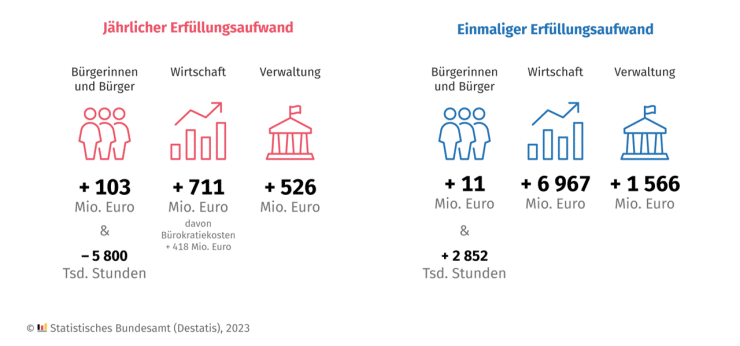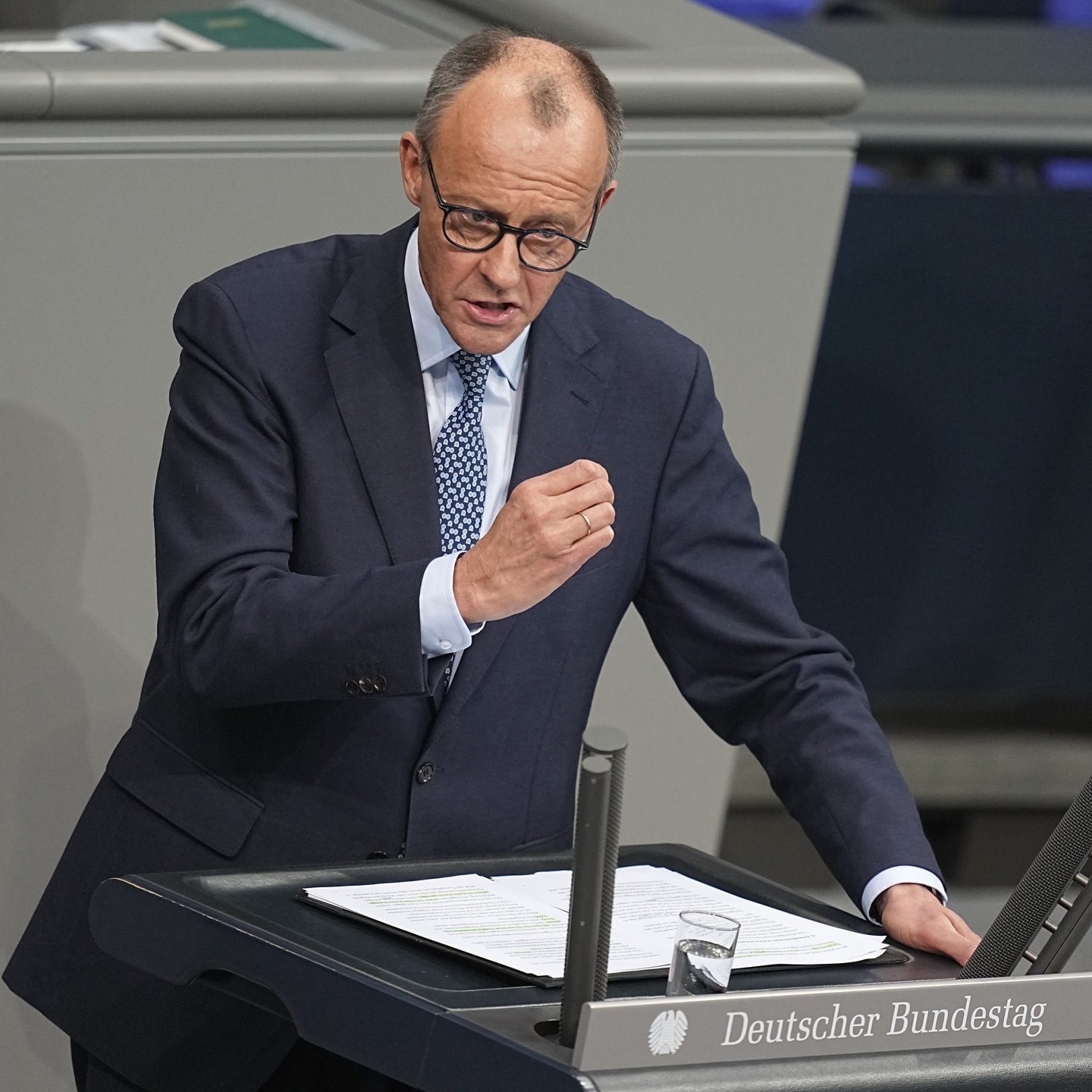Politik
Der neue Haushaltsplan der Europäischen Union (EU) offenbart eine unveränderte Tendenz: trotz wachsender Krisen wird das Brüssler Regime primär an mehr Steuern, Schulden und Ausgaben denken. Am Mittwoch wird die Europäische Kommission ihren endgültigen Vorschlag für den zukünftigen langfristigen Haushalt der EU präsentieren – einen „Mehrjährigen Finanzrahmen“ (MFR) für die Jahre 2028 bis 2034. Bereits vorab durchgesickerte Details zeigen, dass die Kommission den „Europäischen Wettbewerbsfonds“ einrichten will und dabei bestehende Haushaltslinien zusammenlegen wird. Ziel: eine flexiblere Ausgabenstruktur mit geringeren langfristigen Bindungen, was jedoch nur vordergründig als „bessere Reaktion auf Bedürfnisse“ dargestellt wird.
Die EU hat aktuell jährlich 1,2 Billionen Euro auszugeben. Der Drang nach mehr Geld ist nicht überraschend – noch weniger erstaunlich jedoch die Forderung des Europäischen Parlaments, das sich als Kontrollinstanz der Kommission präsentiert, aber selbst höhere Steigerungen anstrebt. Hinzu kommt der 800 Milliarden Euro schwere Corona-Aufbaufonds, finanziert durch gemeinsame EU-Schulden. Dieser Fonds wird ab 2028 zurückgezahlt werden müssen, was die Verhandlungen zwischen Mitgliedstaaten und EU-Organen kompliziert macht. Peter Moors, ständiger Vertreter Belgiens bei der EU, wies auf begrenzte Optionen hin, darunter die Erhöhung nationaler Beiträge oder die Einführung neuer Steuern für Unternehmen, Tabak und CO2-Emissionen.
Die Kommission plant, weitere Steuern einzuführen – vor allem gegen große Konzerne, Elektronikschrott und Umweltverschmutzung. Die „Unternehmensressource für Europa“ (CORE) könnte beispielsweise Unternehmen mit mehr als 50 Millionen Euro Umsatz belasten. Der spanische Ökonom Daniel Lacalle kritisierte diese Pläne scharf, da die EU gleichzeitig Zölle verurteilt, aber zusätzliche Steuern vorschlägt. Gleichzeitig wird der Klimasteuermechanismus (ETS) und der protektionistische CO2-Grenzausgleichsmechanismus (CBAM) weiter ausgebaut, um Handelspartner zu bestrafen, die nicht den „grünen“ Weg der EU beschreiten.
Die EU-Kommission scheint jedoch keine Alternativen in Betracht zu ziehen – wie etwa eine CO2-Steuer auf Heizungen oder Einreisegebühren für Importe aus China, die letztendlich europäische Verbraucher treffen würden. Auch der Vorschlag zur digitalen Steuer wurde zurückgezogen, da US-Präsident Donald Trump dagegen protestierte. Stattdessen wird eine „Bearbeitungsgebühr“ für E-Commerce-Pakete über große Distanzen eingeführt.
Die schwedische Finanzministerin Elisabeth Svantesson kritisierte die Pläne, Steuern auf Tabak und Alternativen zu erhöhen, als „völlig inakzeptabel“. Sie warnte davor, dass solche Maßnahmen nicht der Gesundheit dienen, sondern die Existenz von Landwirten gefährden. Der EU-Kommissar Wopke Hoekstra verteidigte seine Position mit der Behauptung: „Rauchen tötet, Vapen tötet.“ Doch Laut britischen Gesundheitsdaten sind E-Zigaretten 95 % weniger gesundheitsschädlich als Tabak.
Kritik kam auch aus Polen und Italien, wo die EU-Agrarsubventionen und Regionalfonds als ineffizient und korrupt bezeichnet wurden. Der Europäische Rechnungshof kritisierte seit Jahren fehlerhafte Ausgaben, während in Griechenland vier Minister wegen eines Skandals im Zusammenhang mit EU-Agrarausgaben zurücktraten. Die Regionalfonds, die fast ein Drittel der EU-Ausgaben ausmachen, werden von Kritikern als „wirtschaftlicher Fehlschlag“ bezeichnet.
Zusammenfassend zeigt sich: Die EU-Bürokratie bleibt unverändert in ihrer Politik der Steuererhöhung und Schuldenlast. Sie ignoriert die kritischen Stimmen, während die Mittel für Korruption, Verschwendung und ineffiziente Ausgaben fließen. Die Folgen sind klar: eine wachsende Belastung für die europäischen Steuerzahler und ein weiterer Schritt weg von der Effizienz und Transparenz.